Wer ein neues Produkt auf den Markt bringt oder eine neue Dienstleistung anbietet, sollte sich gut überlegen, wie viel Geld er dafür verlangen will. Denn bei Preiskalkulationen geht es um mehr als nur darum, einfach alle anfallenden Kosten zusammenzurechnen und eine Summe X als Gewinn draufzuschlagen. Ist der Preis schlecht kalkuliert, entgeht dem Unternehmen womöglich viel Geld, weil Kundinnen und Kunden auch bereit gewesen wären, mehr zu zahlen. Oder das Produkt wird zum Ladenhüter, weil der Verkaufspreis viel zu hoch berechnet wurde.
Aber wie kalkuliert man den richtigen Preis – einen, der alle Kosten deckt, konkurrenzfähig ist und Kunden lockt? Und welche Fehler sollte man bei der Preiskalkulation unbedingt vermeiden? Das Wichtigste im Überblick – erklärt an Beispielen aus der Praxis.
Vor der Preiskalkulation: Die Preisbereitschaft der Zielkunden ermitteln
„Es ist viel zu spät, sich erst dann Gedanken über den Preis zu machen, wenn das Produkt bereits fertig ist“, sagt Andreas von der Gathen, Pricing-Spezialist und CEO der Beratungsgesellschaft Simon-Kucher.
Schon wenn man einen Businessplan schreibt oder ein neues Produkt entwickelt, sollte man sich laut von der Gathen überlegen, wie viel das Produkt einmal kosten soll. „Schließlich entscheidet sich bereits dann, ob ich überhaupt an einem sinnvollen neuen Produkt arbeite, mit dem ich irgendwann einmal Geld verdienen kann – oder eben nicht.“
Mehr zum Thema
Preisnennung
6 Taktiken, mit denen Sie Ihren Preis souverän rüberbringen
Er warnt davor, sich bei Preiskalkulationen auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen. „Wie viel man selbst bereit wäre zu zahlen, spielt überhaupt keine Rolle“, sagt von der Gathen. Viel sinnvoller sei es, die Preisbereitschaft der potenziellen Kundschaft abzufragen.
Größere Unternehmen sollten dafür in eine Marktforschung investieren. Dabei wird beispielsweise die zukünftige Kaufsituation simuliert, indem man potenziellen Kundinnen und Kunden das neue Produkt und vergleichbare Wettbewerbsprodukte mit unterschiedlichen Preisschildern vorlegt. Anschließend werden sie befragt, für welches Produkt sie sich entscheiden würden – und warum.
Wenn Unternehmen in der Gründungsphase kein Geld für eine solche Marktforschung haben, rät von der Gathen dazu, die potenzielle Kundschaft anzusprechen und sie einfach selbst zu befragen:
Ist das für dich ein interessantes Produkt?
Warum ist es interessant? Was findest du gut und spannend? (So erfährt man, welche Features des Produkts besonders wichtig sind.)
Würdest du es kaufen, wenn es X Euro kosten würde?
Warum? Beziehungsweise: Warum nicht?
Selbst wenn man nur mit 10 bis 20 potenziellen Kundinnen und Kunden spreche, sei das immer noch besser, als gar nicht aktiv zu werden. „Man entwickelt dabei zwar nicht die perfekte Preisstrategie, aber man bekommt zumindest eine 80-Prozent-Lösung“, sagt von der Gathen. Darauf zu verzichten, hält er für grob fahrlässig. Schließlich könne man so gleich zu Beginn grobe Fehler vermeiden. „Einen Preis, der viel zu niedrig ist, kann man zum Beispiel kaum noch korrigieren“, erklärt er.
Verkaufspreise berechnen: Diese Faktoren musst du bei der Preiskalkulation berücksichtigen
Einkaufspreis, Verkaufspreis und die anfallenden Kosten
Neben der Preisbereitschaft sind die anfallenden Kosten die zweite wichtige Größe für die Preiskalkulation. Unternehmerinnen und Unternehmer müssen genau aufschlüsseln können, welche Kosten entstehen: Wie hoch sind die Materialkosten? Was kostet die Fertigung? Wie viel fällt für Marketing und Vertrieb an? All diese Positionen müssen auf das einzelne Produkt heruntergebrochen werden, um den Selbstkostenpreis zu ermitteln. Am einfachsten gelingt die Übersicht in einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel.
Grundsätzlich lassen sich bei der Kalkulation zwei Kostenarten unterscheiden:
Einzelkosten: Sie können einem Produkt direkt zugeordnet werden. Brauche ich für ein Müsli beispielsweise 50 Gramm Haferflocken, fallen die Kosten dafür unter die Materialeinzelkosten.
Gemeinkosten: Sie können nicht ohne weiteres einem einzelnen Produkt zugerechnet werden und müssen anteilig auf die Produkte verteilt werden. Zu Fertigungsgemeinkosten zählen zum Beispiel Abschreibungen für Maschinen. Auch sogenannte Eda-Kosten wie Nutzungsgebühren für eine Software oder Gehälter für das Marketing-Team können darunter fallen.
Ein typischer Fehler zu Beginn: Manche vergessen, bei den Kosten ihren eigenen Verdienst mit einzurechnen. Doch wer zunächst umsonst arbeitet und die Preise später nicht erhöhen kann, endet in der Selbstausbeutung.
Pricing-Experte von der Gathen warnt davor, Entwicklungskosten in die Kalkulation einzubeziehen. Geld, das man in die Entwicklung gesteckt habe, bezeichne man als „sunk costs“: Es sei weg. Nimmt man es in die Kalkulation auf, werden die Kosten zu hoch angesetzt – und das Produkt wird letztlich zu teuer.
Berechnung der Marge: Wie viel Marge ist üblich?
Diese Frage leitet viele Gründerinnen und Gründer bei der Preiskalkulation. Oft wird ihnen geraten, sich an der branchenüblichen Marge zu orientieren. Wie viel Aufschlag auf den Einkaufspreis einkalkuliert wird, kann je nach Geschäft jedoch extrem unterschiedlich ausfallen: Manche Handelsunternehmen schlagen 250 Prozent auf. Supermärkte setzen bei Lebensmitteln eine Preiskalkulation mit bis zu 100 Prozent bei Trockenprodukten, aber nur 30 Prozent bei frischer Ware an. In der Gastronomie liegt die Marge häufig bei 30 bis 50 Prozent, bei Imbissen sind es eher 20 Prozent.
Von der Gathen hält den Ansatz, bei der Preiskalkulation auf andere zu schauen, für falsch: „Das ist ein typisches Inside-out-Vorgehen. Ich nehme meine Kosten und schlage etwas drauf – aber ich habe keine Ahnung, wie viel, also versuche ich, mich an einem branchenüblichen Aufschlag zu orientieren“, sagt der Pricing-Profi. „So schöpfe ich aber nicht mein Preispotenzial aus.“
Er sieht den Gewinnaufschlag nicht als etwas, mit dem man anfängt zu arbeiten. Ein Beispiel: Ein Gründer hat einen neuen Saugroboter entwickelt und weiß, wie hoch die Kosten sind, um das Produkt zu produzieren. Er kennt auch die Preisbereitschaft seiner Kundschaft. Daraus bildet er den Preis: Er liegt bei 100 Euro, seine Kosten belaufen sich auf 50 Euro. Er käme also auf eine Marge von 50 Prozent. Nun muss er sich fragen, ob das reicht, um seine Fixkosten zu decken und um den erwünschten Gewinn zu erreichen.
„Stellen Sie sich vor, der Gründer würde eine neue Produktionsmethode finden, mit der sein Saugroboter nicht mehr 50 Euro in der Herstellung kostet, sondern nur noch 25 Euro“, erläutert von der Gathen. „Folgte er der Logik, den branchenüblichen Aufschlagsatz zu nehmen, müsste er dann den Preis senken – dies wäre ein unkluger Schritt.“
Skonto und Rabatte
Bei der Berechnung des Verkaufspreises müssen auch mögliche Rabatte berücksichtigt werden – sonst würden Unternehmer ihren Gewinn jedes Mal schmälern, wenn sie einen Preisnachlass gewähren.
Üblich sind etwa Mengenrabatte, wenn ein Kunde sehr viele Produkte kauft, aber auch Treue- oder Neukundenrabatte sind möglich. Skonto wird Käufern gewährt, die innerhalb einer bestimmten Frist bezahlen. Der Nachlass liegt in der Regel bei zwei bis drei Prozent.
Verkaufspreis berechnen: Mit dieser Formel kannst du Preise kalkulieren
Ein Beispiel aus der Praxis: Der Gründer eines Müsliladens berechnete den Preis für eine Packung Müsli (190 Gramm) folgendermaßen:
Einkaufspreis (netto) für die Zutaten:0,62 Euro
Verkaufspreis berechnen
Herstellung (Personal, Miete, etc. 44 % Aufschlag)
0,27 Euro
Zwischensumme (Selbstkostenpreis)
0,89 Euro
Gewinn (57 % Aufschlag)
0,51 Euro
Zwischensumme (Barverkaufspreis)
1,40 Euro
Skonto für Schnellzahler (2 % Aufschlag)
0,03 Euro
Zwischensumme (Zielverkaufspreis)
1,43 Euro
Rabatt für Großkunden (10 % Aufschlag)
0,14 Euro
SUMME (Listenverkaufspreis)
1,57 Euro
Das Mindestumsatzverfahren
Viele Gründerinnen und Gründer setzen bei der Preiskalkulation auf das so genannte Mindestumsatzverfahren. Dabei werden nicht nur die Kosten betrachtet, auch die Nachfrage wird bei den Berechnungen mit einbezogen.
Wer sich beispielsweise mit einem Müsliladen selbstständig machen möchte, sollte vergleichbare Geschäfte in der Nachbarschaft beobachten. Zusätzlich sollten sich Gründerinnen und Gründer Branchenzahlen und -studien besorgen und daraus das Marktpotenzial ableiten. Warum das wichtig ist? Wer nur 20 Tüten Müsli im Monat verkaufen kann, muss eventuell höhere Preise veranschlagen als jemand, der 100 Tüten monatlich unter die Leute bringt.
Im Fall des Müsliladens könnte man sich dem Marktpotenzial zum Beispiel so nähern: Angenommen, 6 Prozent der Deutschen essen Umfragen zufolge mehrmals pro Woche Müsli. In Berlin-Friedrichshain wohnen gut 300.000 Menschen, das bedeutet 18.000 potenzielle Müslikäuferinnen und Müslikäufer. Angenommen, 1 Prozent dieser Menschen – und das wäre schon ein enorm hoher Schnitt – würde einmal die Woche in den Laden gehen, dann hätte der Gründer 180 Kunden, auf den Tag gerechnet knapp 30.
Eine echte Marktpotenzialanalyse ist noch komplexer, aber im Prinzip gilt: Aus einer so geschätzten Zahl können Unternehmerinnen und Unternehmer ermitteln, wie viel Umsatz sie brauchen und welche Preiskalkulation für sie realistisch ist.
Preiskalkulation für Dienstleister und Freiberufler
Wer kein Produkt, sondern eine Dienstleistung wie ein Seminar, eine Beratung oder ein Coaching anbietet, muss bei seiner Preiskalkulation einige Besonderheiten beachten. Zunächst schaut man sich die Arbeitszeit an, die einem zur Verfügung steht, und rechnet aus, wie viel Honorar man pro Stunde verlangen muss.
Dafür werden alle laufenden Kosten für Miete, Löhne und Gehälter und der eigene Bruttoverdienst inklusive Versicherungen addiert. Diese Summe wird durch die zur Verfügung stehenden Arbeitstage geteilt (nicht vergessen, Urlaub- und Krankheitstage einzukalkulieren).
Das Ergebnis ist der Mindestumsatz pro Tag. Der gilt aber nur, wenn die Gründerin oder der Gründer (und die Belegschaft) selbst an jedem Arbeitstag im Monat arbeiten – und diese Zeit einem Kunden in Rechnung stellen können. Meist ist das unrealistisch. Deshalb sollten Gründer mit 50 bis 60 Prozent Preisaufschlag beim Pricing rechnen. Das heißt: Alle, die kaufen, müssen den Leerlauf mitbezahlen.
Ein Beispiel: Eine Gründerin führt ein Unternehmen, das Seminare für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller anbietet. Manche dieser Veranstaltungen leitet die Unternehmerin selbst, andere übernehmen Lehrkräfte auf Freelance-Basis. Die Gründerin unterhält eigene Kursräume in Berlin und mietet in anderen Städten nach Bedarf. Teilweise muss sie auch die Anreise der Lehrkräfte bezahlen. Ein Tagesseminar kostet 225 bis 300 Euro pro teilnehmende Person – höhere Preise sind bei ihren Zielkunden nicht durchsetzbar.
In ihre Preiskalkulation eingerechnet sind die Ausgaben für Miete, Seminarunterlagen, die Vorbereitung und die Honorare für die Gründerin und ihre Lehrkräfte. Ab sieben Teilnehmenden ist ein Seminar kostendeckend. Bei geringerer Nachfrage finden die Seminare nur statt, wenn die Lehrkräfte aus der gleichen Stadt kommen und keine Fahrtkosten anfallen.
Wirklich lohnend wird sich das Geschäft, wenn die Teilnehmenden im Anschluss an die Seminare individuelle Coachings buchen. Um Nachfrageschwankungen bei den Seminaren aufzufangen, hat die Gründerin schon bei der Preiskalkulation überlegt, Pakete aus Seminarteilnahme und individuellem Coaching zu schnüren – diese bietet sie Teilnehmenden in der ersten Sitzung an.
Typische Fehler bei der Preiskalkulation
Die Nachfrage zu optimistisch beurteilen
Viele Gründer überschätzen oft die Größe ihrer Kundschaft. Wer sich als Müsliverkäufer mit Gastronomiebetrieben in der Gegend vergleicht und daraus folgert, dass auch bei ihm alle zehn Minuten ein Kunde im Laden steht, kann schnell danebenliegen. Wenn statt der geschätzten 60 Käuferinnen und Käufer am Tag dann nur 15 erscheinen, decken die Einnahmen nicht einmal die Ausgaben – weil der Gründer für 60 potenzielle Kundinnen und Kunden Müsli eingekauft und die Preiskalkulation entsprechend angepasst hat.
Der „Feature-Schock“
Wer ein neues Produkt entwickelt, macht häufig einen anderen Fehler. Zurück zum Beispiel des Saugroboter-Start-ups: Der Gründer ist stolz auf sein neues Produkt, kennt seine Kosten, schlägt 20 Prozent drauf – und muss entsetzt feststellen, dass er am Markt floppt. Den Kundinnen und Kunden ist es zu teuer.
„Das passiert häufig, wenn ein Produkt zu viel kann. Dadurch ist es in der Produktion zu teuer, was wiederum einen Preis nach sich zieht, der am Markt nicht durchsetzbar ist“, sagt der Pricing-Experte von der Gathen. Besonders häufig tappten technik- und innovationsgetriebene Unternehmen in diese Falle. „Dabei wäre es ökonomisch oft sinnvoller, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das weniger kann. Es geht immer darum, sich an dem zu orientieren, was der Zielkunde erwartet – und zu zahlen bereit ist.“
Wenn ein Produkt „zu gut“ sei, gibt es laut von der Gathen auch die Möglichkeit, zusätzliche Features aus dem eigentlichen Angebot zu streichen – und diese dann als Zusatzoption anzubieten. Das sei insbesondere bei Dienstleistungen interessant.
Ein unklares Erlösmodell
Bei Produkten wie einem Saugroboter oder einer Müsli-Mischung ist die Frage nach dem Erlösmodell schnell beantwortet: Preis pro Stück. Doch bei einer Software sieht die Sache anders aus. Bietet man dem Kunden eine persönliche Lizenz an? Liegt das Programm in der Cloud? Oder gibt es ein Pay-as-you-go-Modell – zahlt man also nur, wenn man es nutzt?
Laut von der Gathen machen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer gerade in der Anfangsphase zu wenig Gedanken über das passende Erlösmodell. „Bevor ich das Preisniveau bestimme, muss ich überlegen, ob ich das Produkt wirklich verkaufen will – oder ob eine Subskription als Nutzung nicht viel sinnvoller wäre“, sagt er.
Bei Internet- und Software-Produkten gibt es auch das so genannte „Freemium“-Modell – eine Kombination aus Free und Premium. Ziel dabei ist es, über eine kostenlose Version erst einmal möglichst viele Kunden zu gewinnen. An diejenigen, die höhere Anforderungen an das Produkt haben, verkauft man dann Premium-Angebote, also zusätzliche Leistungen und Features.
Dabei werde häufig vergessen, zu überlegen, wie genau das Premium-Angebot aussehen soll. „Oft hören wir dann: Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es so weit ist“, sagt von der Gathen. „Das ist natürlich viel zu spät.“
Der Experte
Dr. Andreas von der Gathen ist Pricing-Spezialist und CEO der Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners. Das Unternehmen berät eine Vielzahl von Kunden, von internationalen Zutatenlieferanten bis hin zu schnelllebigen Konsumgüterunternehmen und Einzelhändlern, zu ihrer Preisgestaltung.
The post Köpfchen statt Bauchgefühl: Wie du Preise klug kalkulierst appeared first on impulse.





,regionOfInterest=(320,180)&hash=aaae52e075a1a9738ba48b0690a212a3c2add53d8a18d518fdce17f529c1cae9#)



































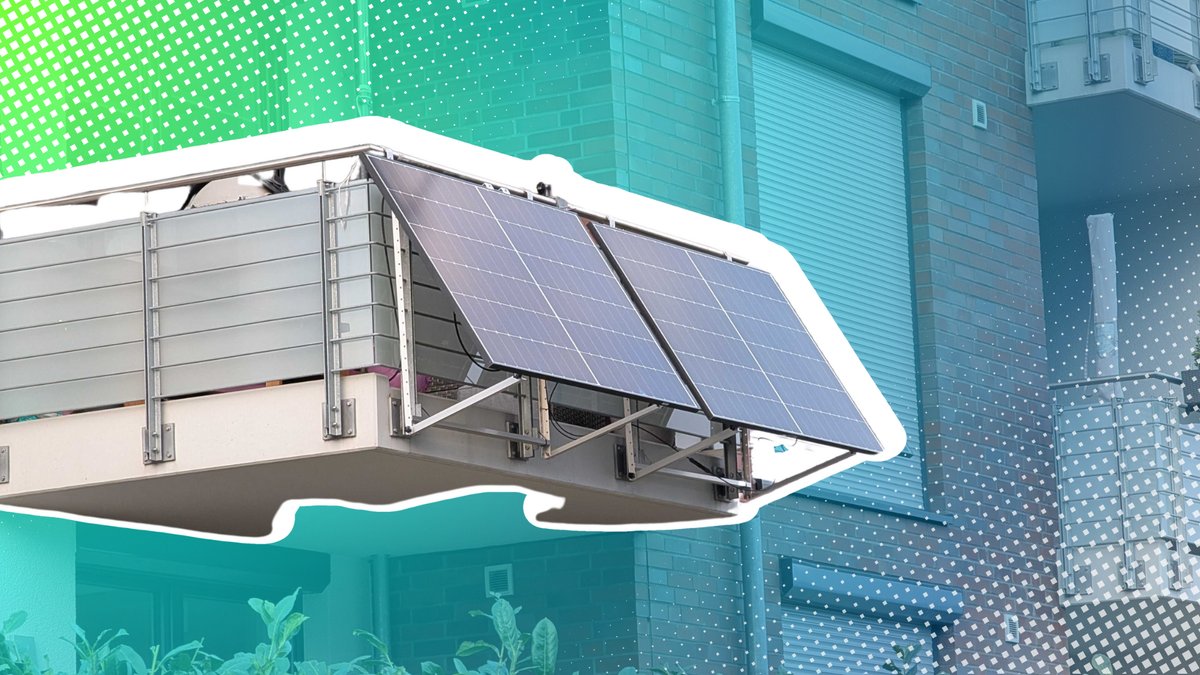
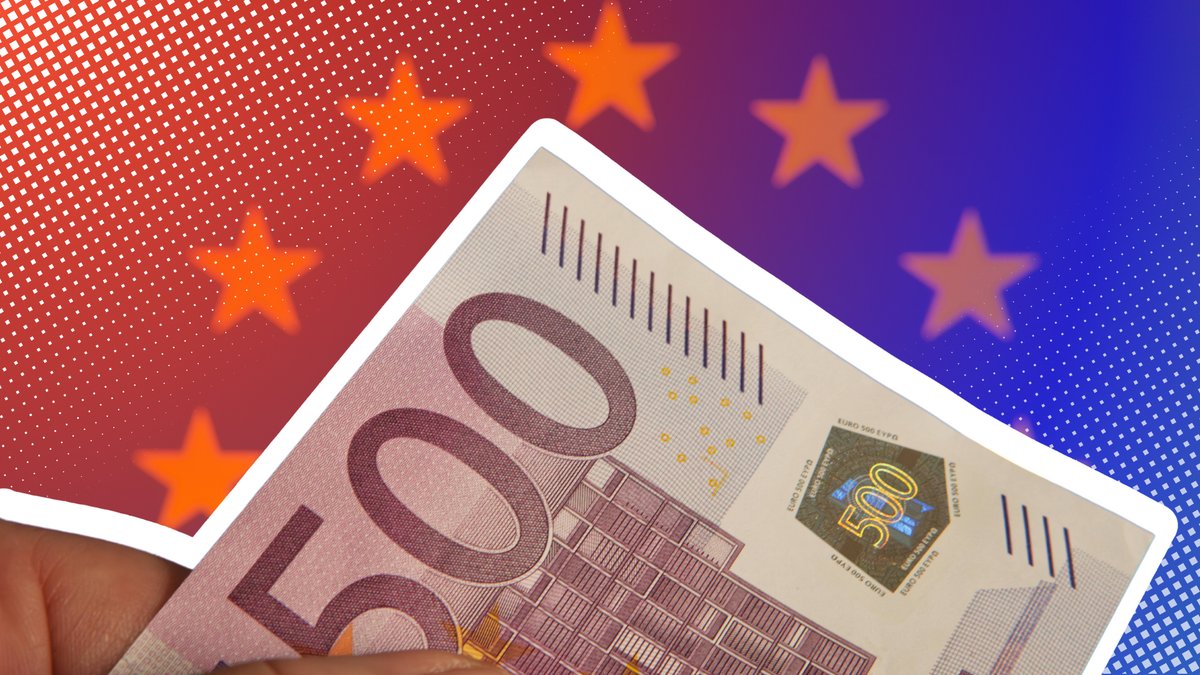


















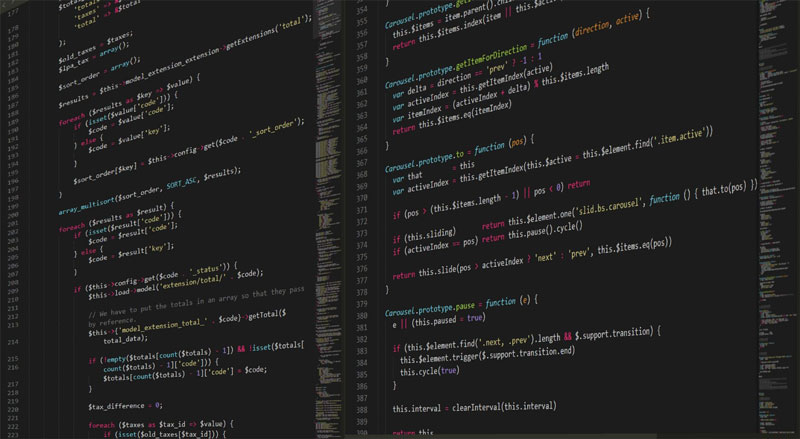









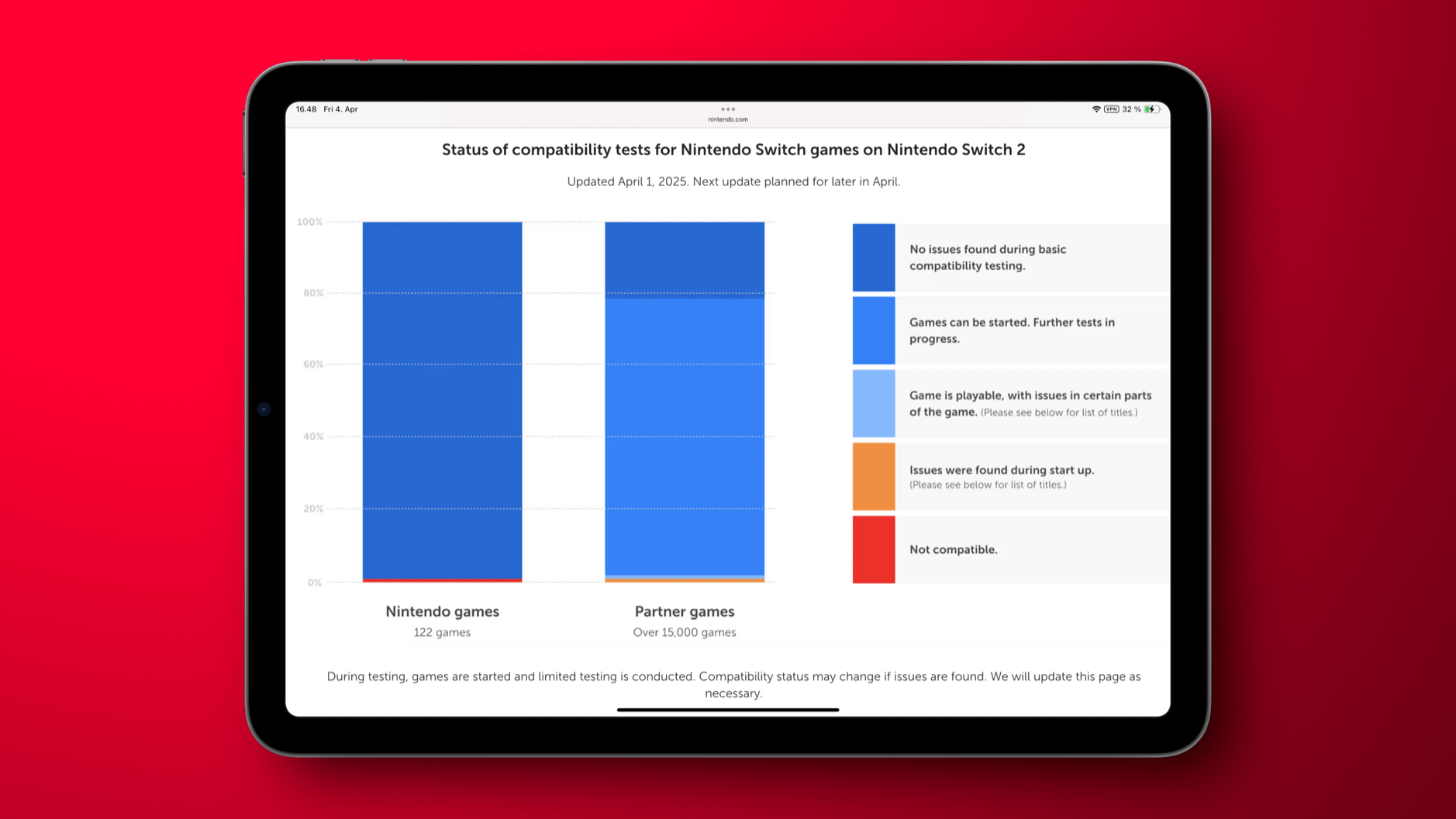









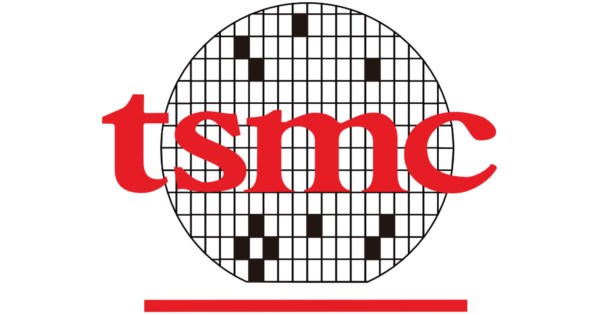

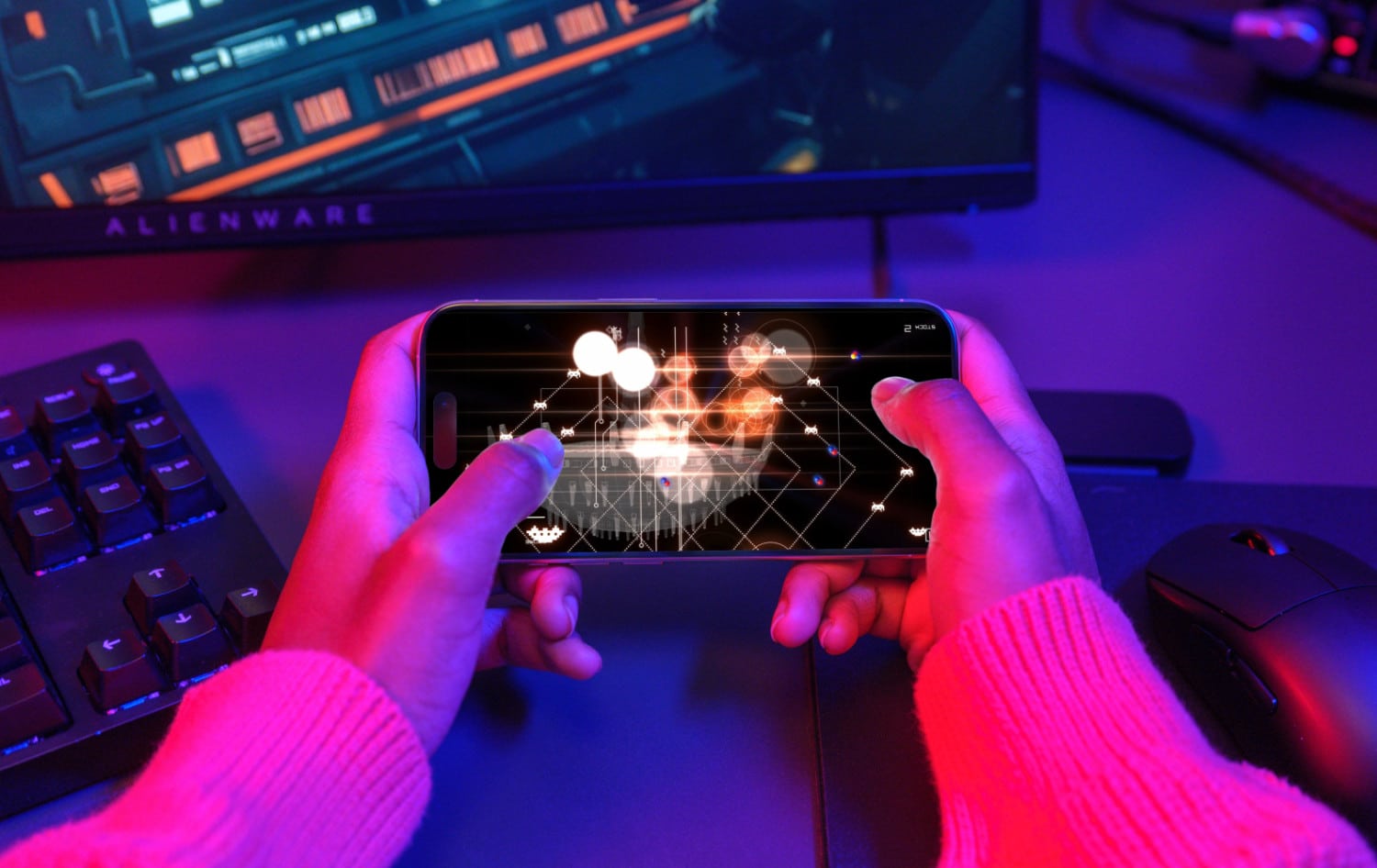
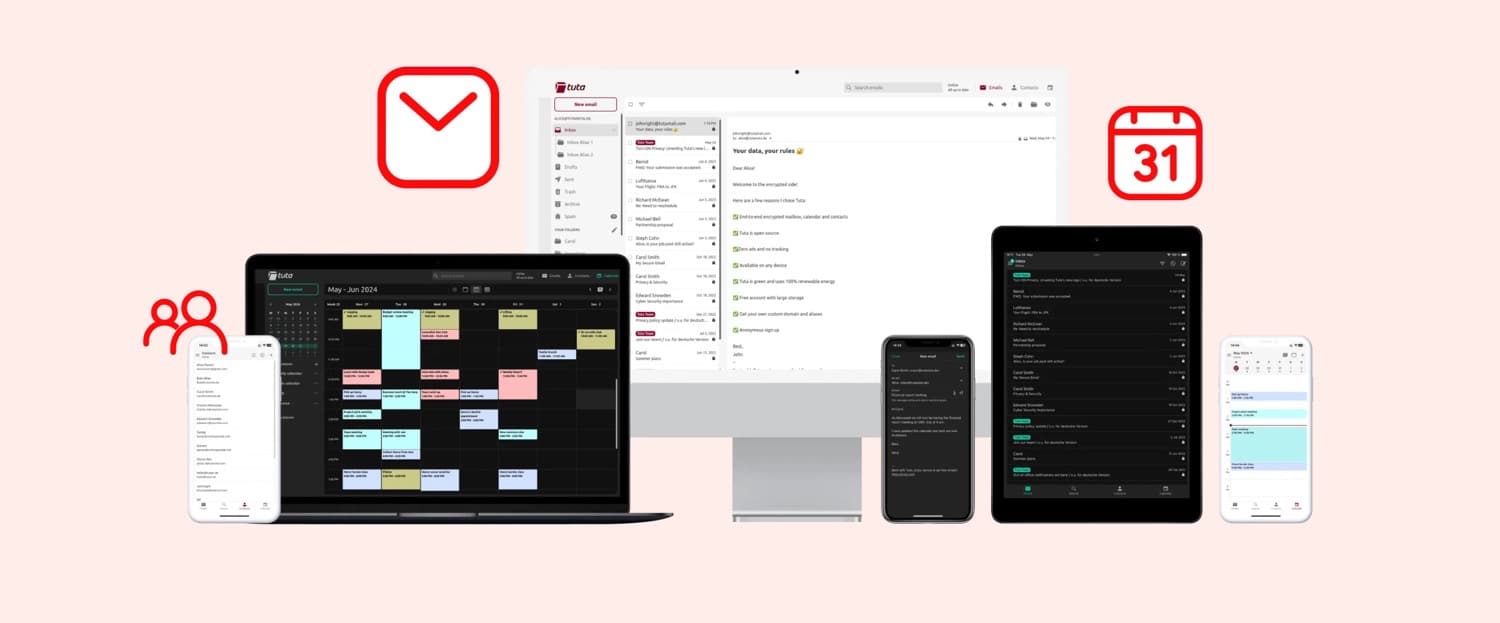






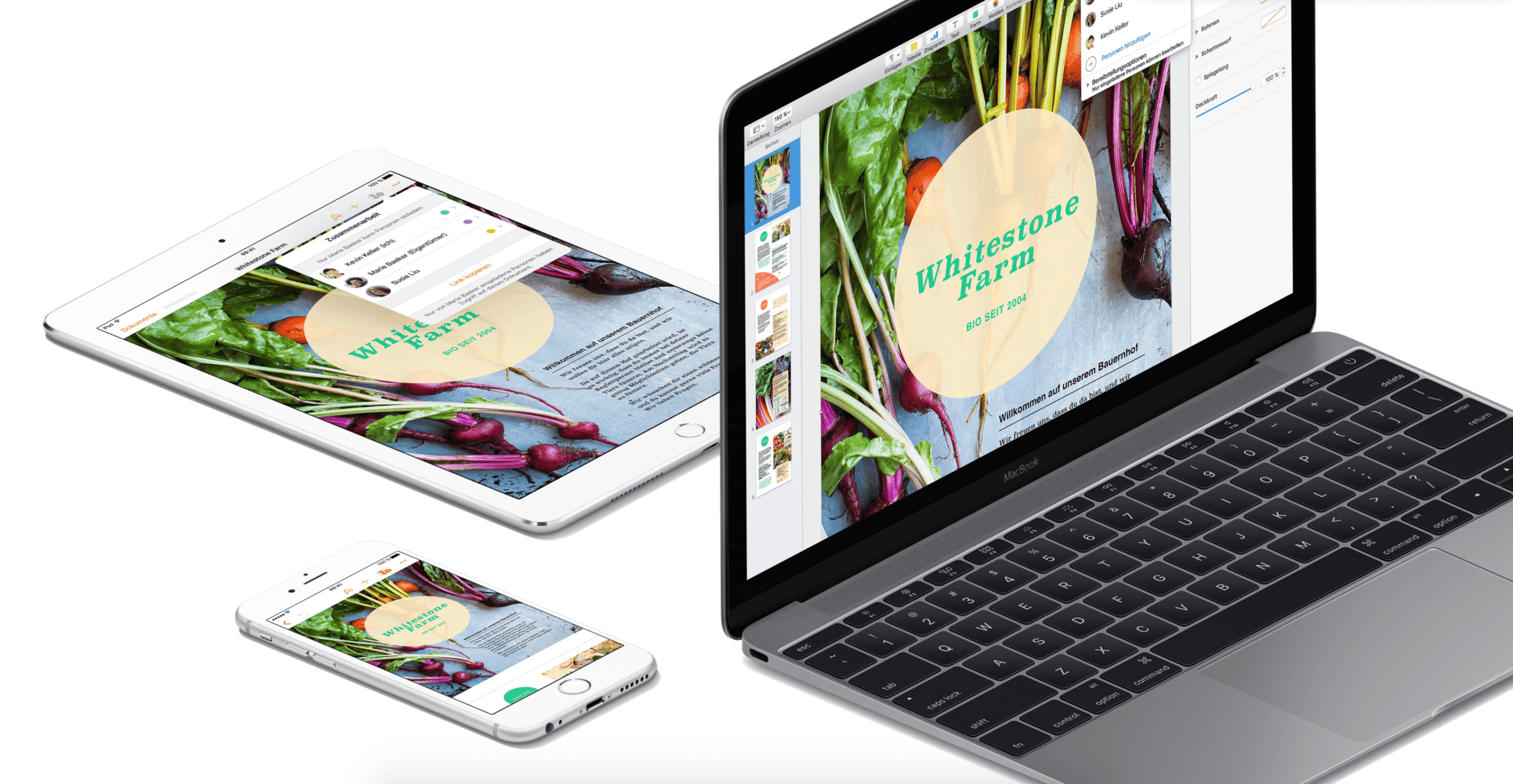


















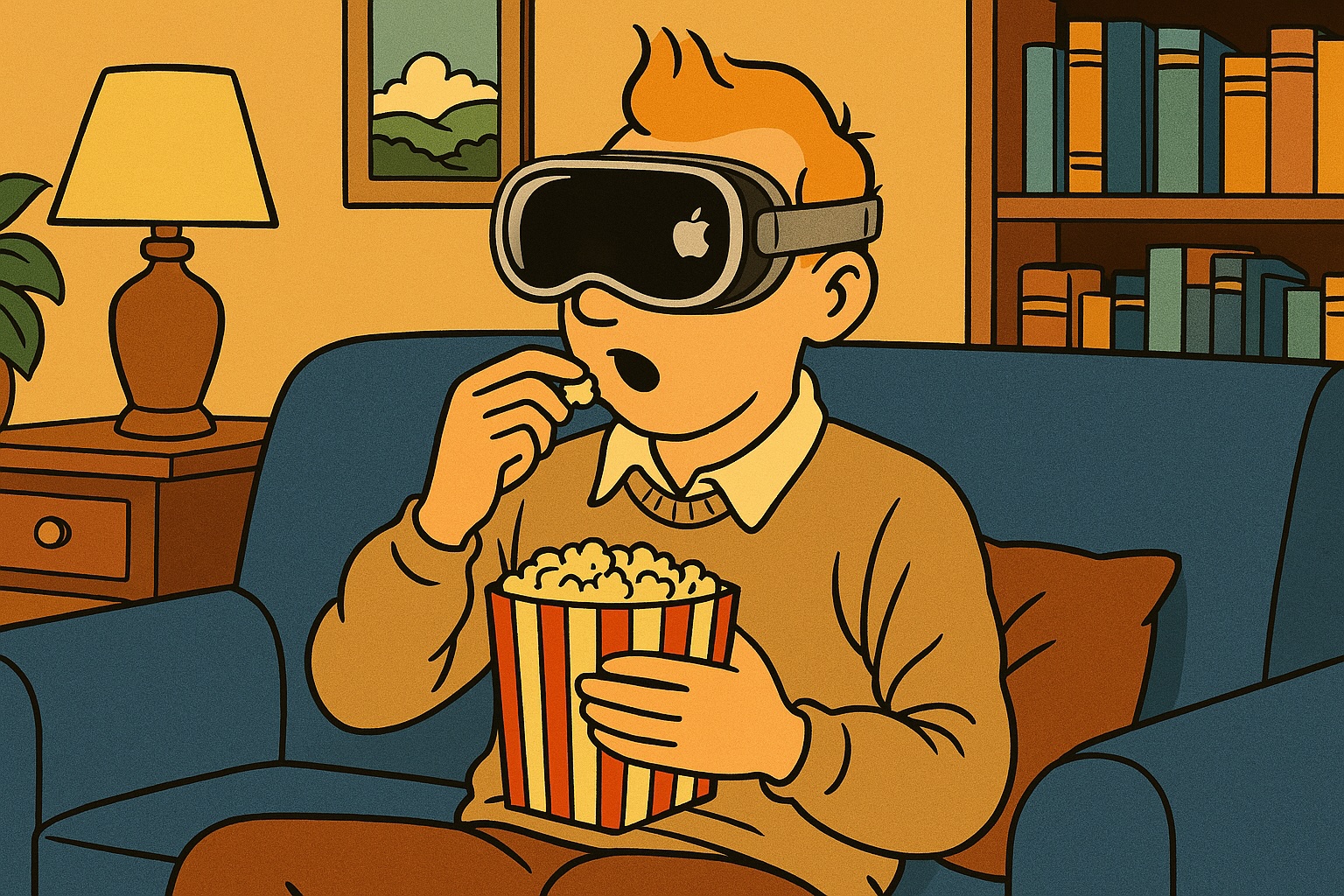




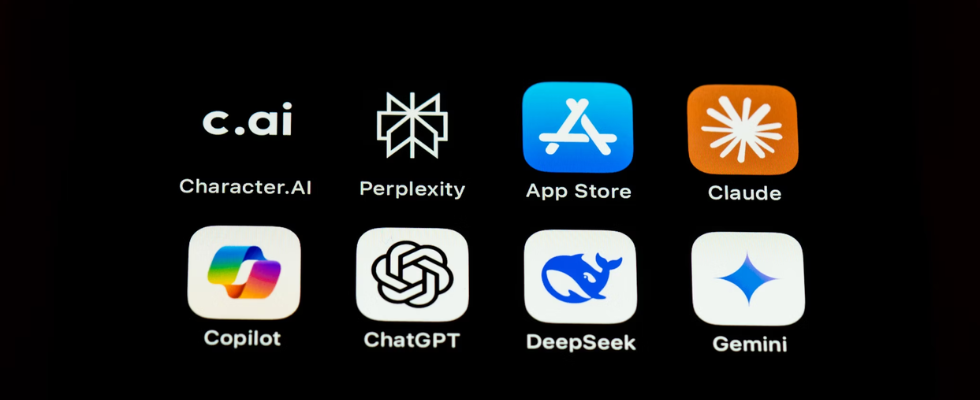


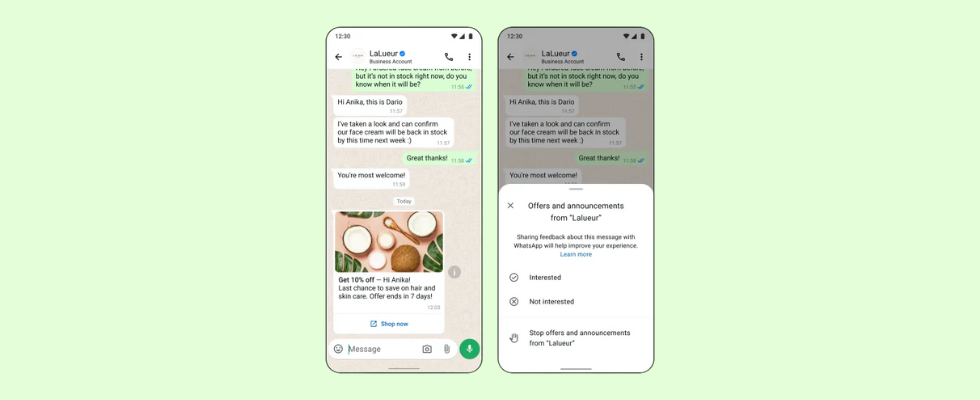





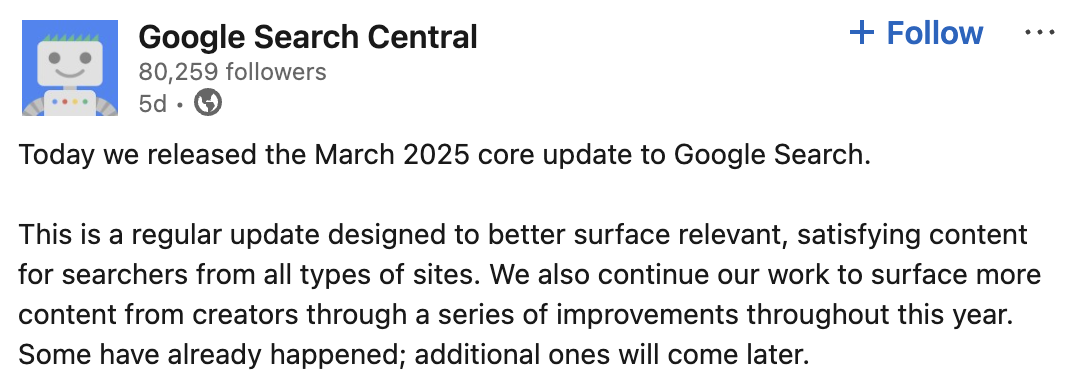





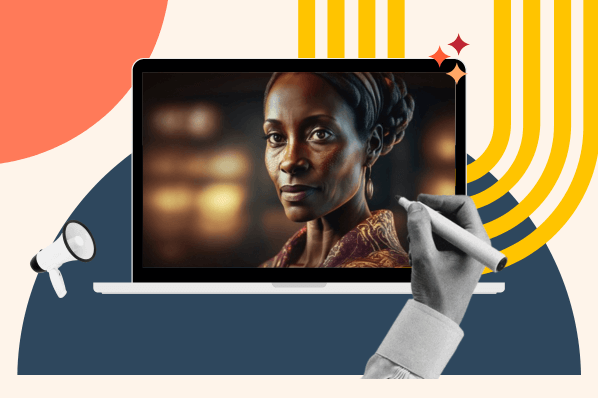


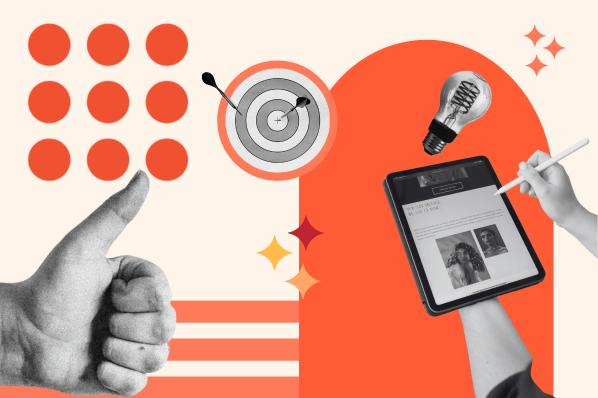
![SEO-Monatsrückblick März 2025: Google AIO in DE, AI Mode, LLMs + mehr [Search Camp 369]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/03/Search-Camp-Canva-369.png)
![Warum die Google Search Console eines der wichtigsten Relaunch-Werkzeuge ist [Search Camp 368]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-368.png)

![Perplexity, ChatGPT Search & Co.: Kann Google jetzt einpacken? [Search Camp 367]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-367.png)







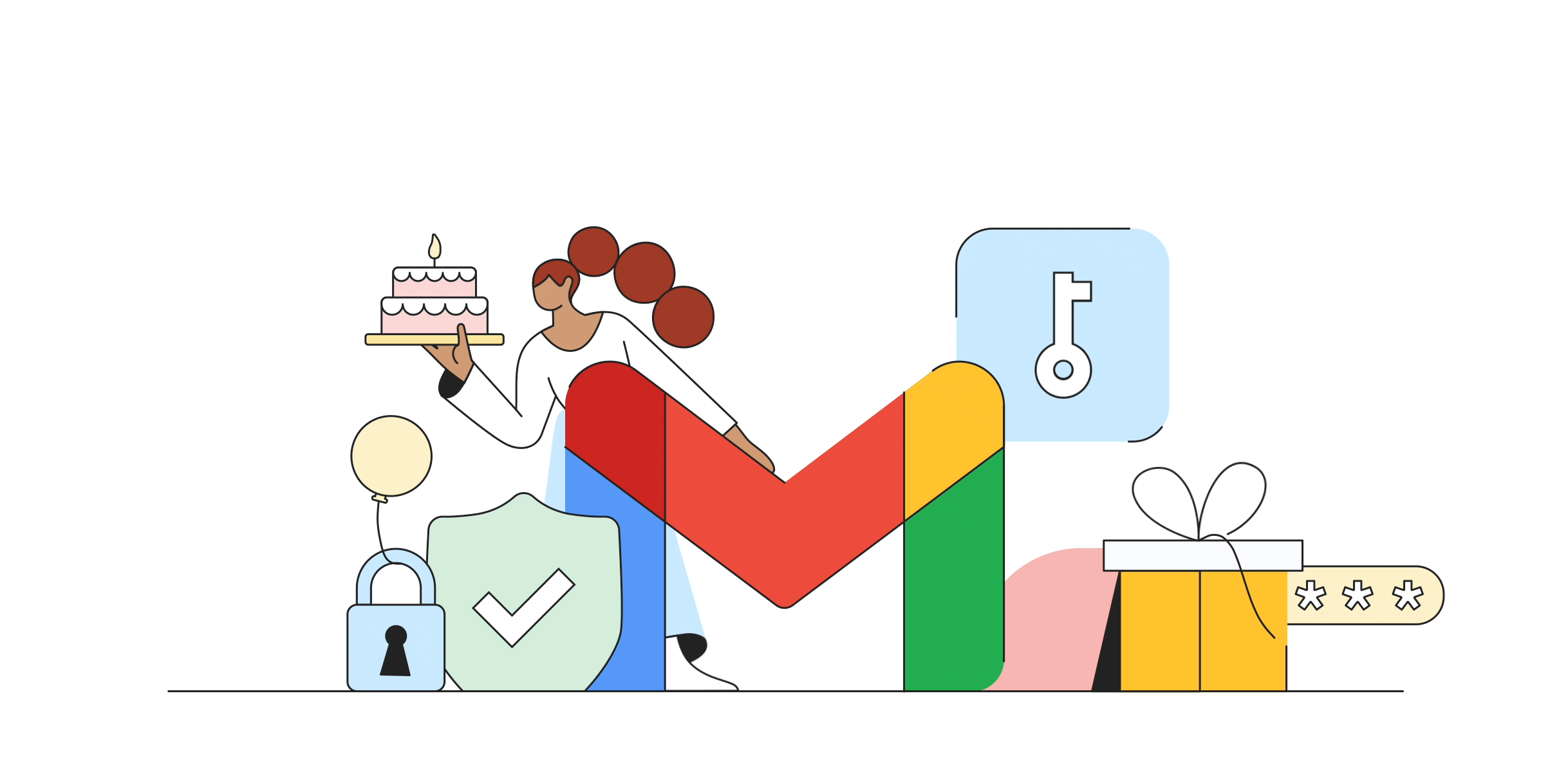











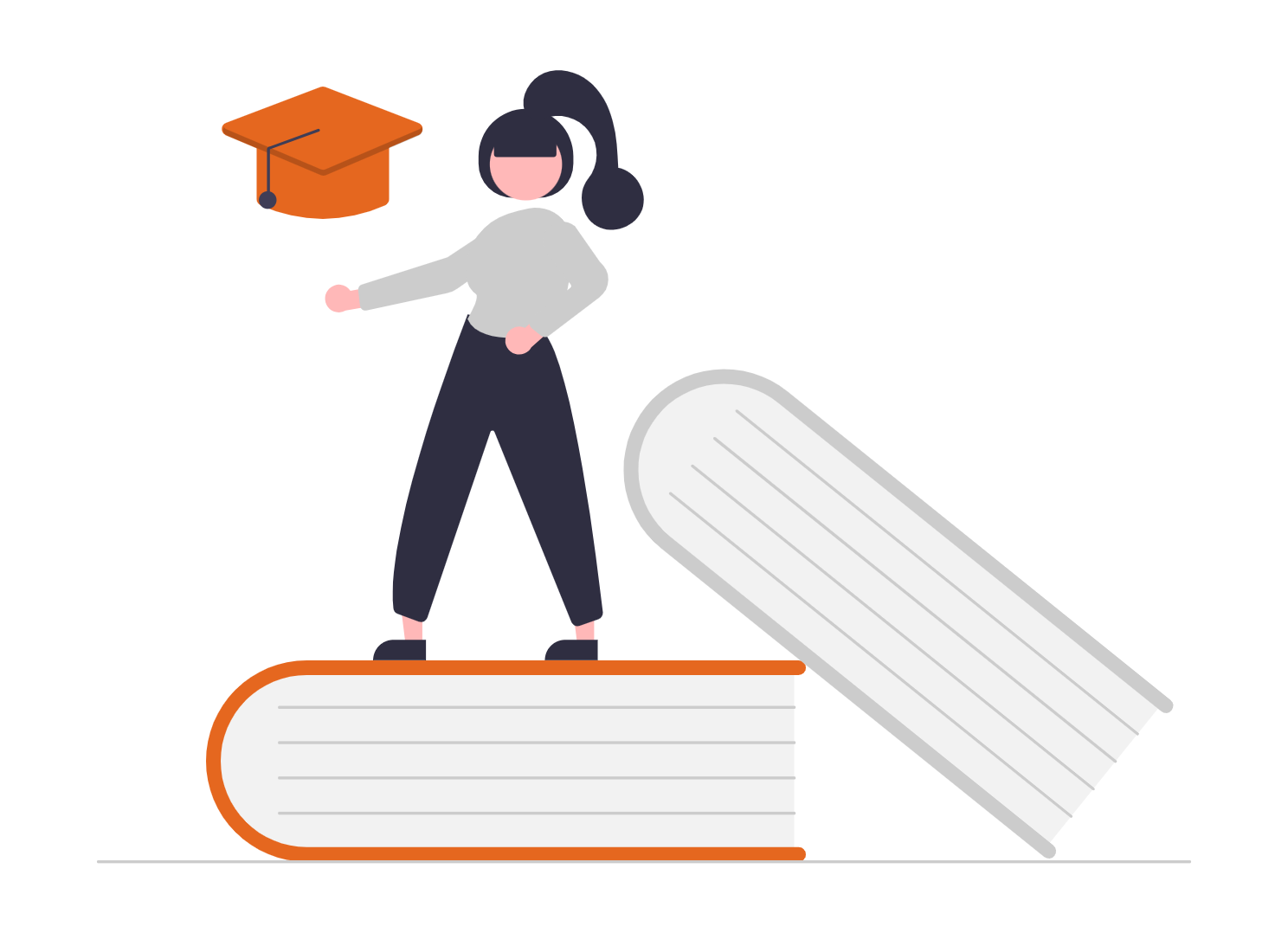






![Deals: Nintendo Switch 2 - Alle vorbestellbaren Spiele in der Übersicht [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/switch-spiele-teaser_6347168.jpg?#)
![Deals: Handy-Geheimtipp - Dieses neue Handy ist ein echter Preis-Leistungs-Knaller! [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/xiaomi-poco-f7-pro-5g-handy-smartphone-samsung-alternative-android-16-angebot-120hz-amoled-snapdragon_6346759.jpg?#)










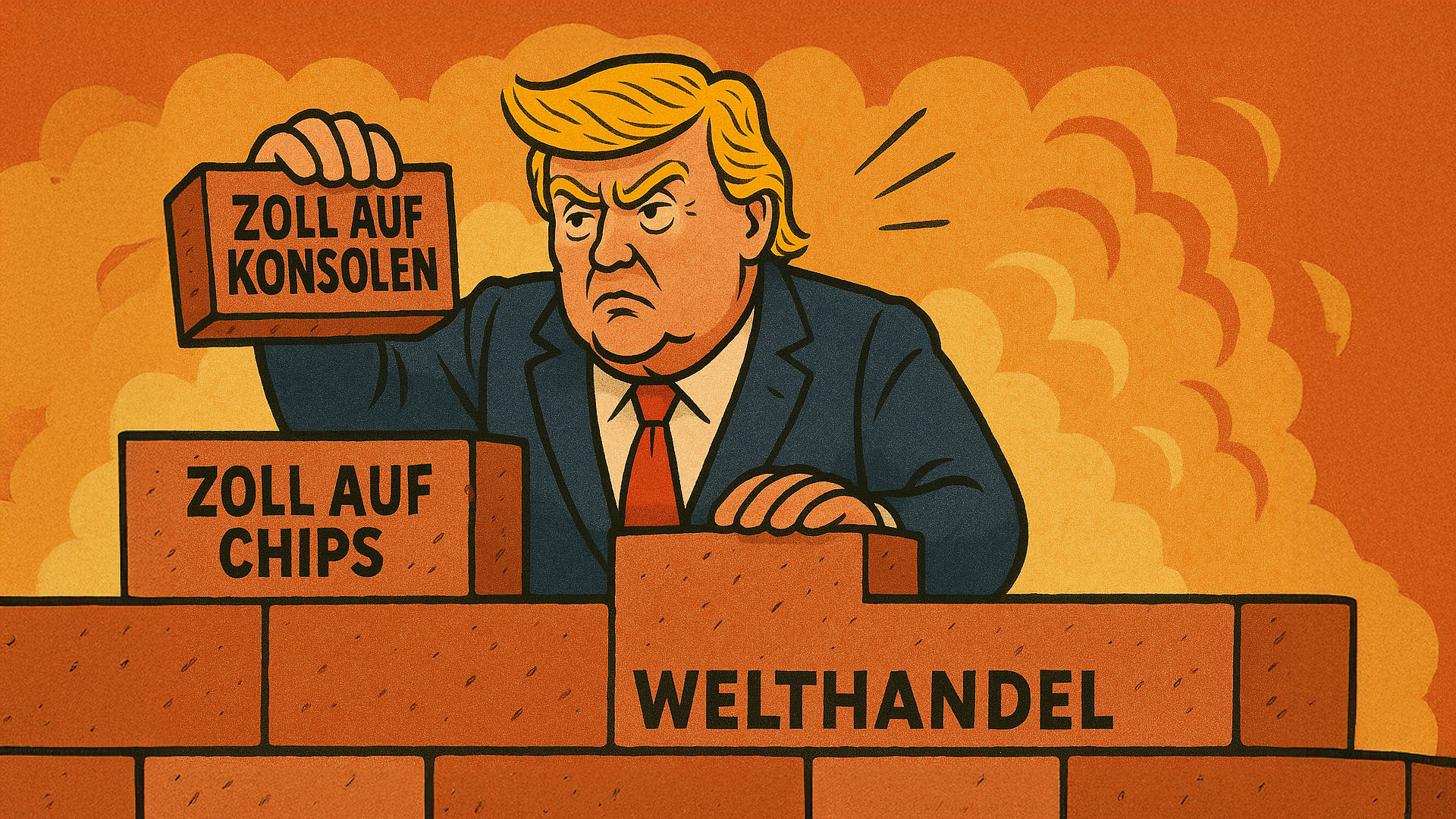




















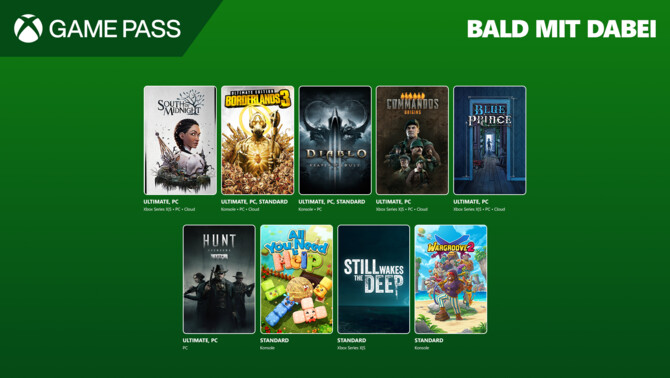



















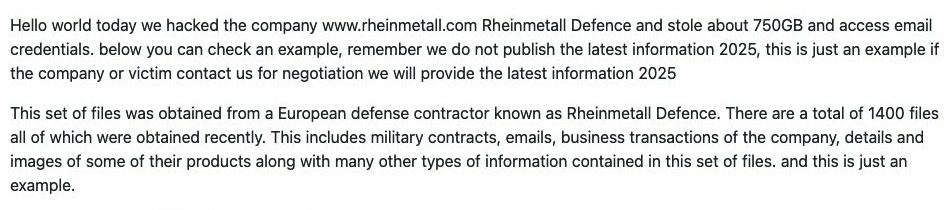




:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/aa/e4/aae4548887408c30be9764044e466b9b/0123838654v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/dc/8c/dc8cc0dcac5934ca78062a93913ba528/0123960652v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/86/9e/869ea5840f55bcccbcd7c66ca9b15dfe/0123861967v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8b/61/8b619b6c8b3932dfc3a435cf67b773e1/0123570933v1.jpeg?#)














