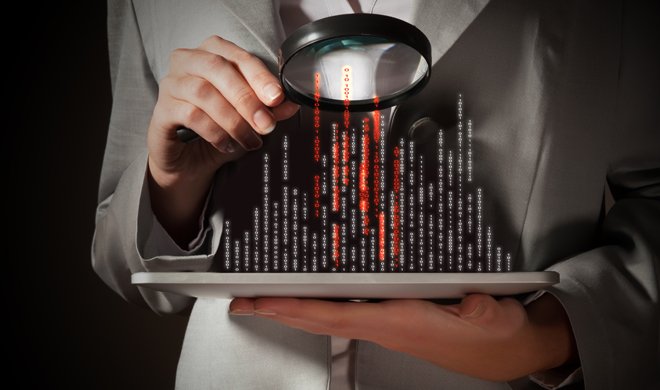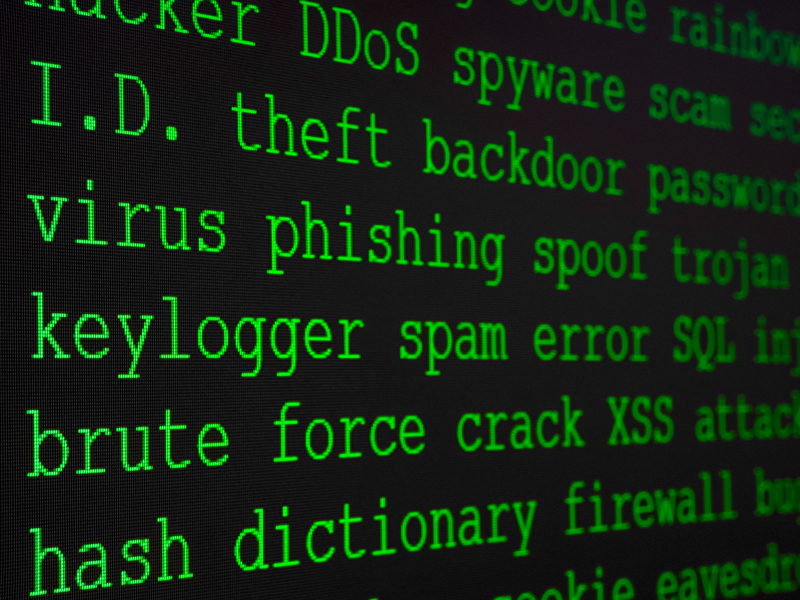Kommentar: Entbürokratisierung ist das neue Zauberwort
1. Einleitung »Bürokratie abbauen«. »Entbürokratisierung«. »Bürokratiearm«. »Selbstbeschränkende Bürokratiebremse«. Diese politischen Schlagworte kommen bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Regel gut an. Schließlich ist der Begriff Bürokratie im Alltag negativ besetzt. Ein Bürokratieabbau muss daher positive Auswirkungen und Vorteile haben. Die Zivilgesellschaft sollte aber sehr genau hinschauen, ob sich hinter dem Etikett »Bürokratieabbau« nicht der […]

1. Einleitung
»Bürokratie abbauen«. »Entbürokratisierung«. »Bürokratiearm«. »Selbstbeschränkende Bürokratiebremse«. Diese politischen Schlagworte kommen bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Regel gut an. Schließlich ist der Begriff Bürokratie im Alltag negativ besetzt. Ein Bürokratieabbau muss daher positive Auswirkungen und Vorteile haben. Die Zivilgesellschaft sollte aber sehr genau hinschauen, ob sich hinter dem Etikett »Bürokratieabbau« nicht der Abbau von Bürgerrechten oder gesellschaftlichen Kontrollfunktionen verbirgt. Denn das Schlagwort »Bürokratieabbau« ist eher zu einem Deckmantel für politische Eigeninteressen verkommen. Deshalb greifen Lobbyverbände wie der Wirtschaftsrat der CDU, Vertreter der Wirtschaft und auch die Politik nur allzu gerne in die »Bürokratie ist schuld«-Schublade.
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (2025) enthält 59 dieser politischen Schlagworte. Es gilt also genau zu beobachten, was sich dahinter verbirgt – meist werden wir es erst in den konkreten Gesetzestexten sehen, denn ein Koalitionsvertrag ist zunächst einmal eine politische Absichtserklärung.
2. Sind »neu justieren«, »reformieren«, »abschaffen« politische Synonyme?
In den Koalitionsverhandlungen 2025 haben wir jedoch erlebt, dass die CDU/CSU das politische Etikett »Bürokratieabbau« mit einer anderen Absicht verwendet. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) – ein wichtiger Baustein demokratischer Transparenz des deutschen Verwaltungshandelns – sollte »unter dem Blickwinkel von Bürokratie und Arbeitsbelastung der öffentlichen Verwaltung« (Zimmermann, 2025) neu justiert werden.
Das Label »neu justieren« kennen wir bereits vom sogenannten Digitalgipfel – wobei die Bezeichnung Daten-Rohstoffgipfel ehrlicher gewesen wäre – der ehemaligen Ampelregierung:
»Das Verhältnis von Datenschutz und Datennutzung werde man »neu justieren müssen«, meinte Scholz.«
(Steiner, 2024).
Interessanterweise lieferte das Koalitionsverhandlungspapier 2025 eine Übersetzung für die politische Floskel »neu justieren«. Die CDU/CSU meinte damit: »Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen.« (Koalitionsverhandlungen CDU/CSU/SPD AG 9 – Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, Moderne Justiz, o. D.).
Im Koalitionsvertrag findet sich jedoch statt einer Abschaffung oder Neujustierung die Absicht, das IFG zu reformieren: »Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung reformieren.« (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2025).
Hier wird man in Zukunft vor allem der CDU/CSU sehr genau auf die Finger schauen müssen, was sie unter »reformieren« (s.o.) mit dem Ziel »Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung« (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2025, Hervorhebung d. Verf.) erreichen will.
»Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Durchschnittsbürger Akten wälzen will. Das würde ja gerade den Normalbürger eher überfordern. Ich kann dem da nämlich 100 Aktenordner hinschieben und was macht der Normalbürger dann damit?
Da kann er gar nichts anfangen. Der einfache Bürger hat eine konkrete Frage und will wissen: Wie ist das so? Oder: Warum ist das so?«
(Open Knowledge Foundation Deutschland, 2018)
Äußerungen von Unionspolitikern wie z.B. Joachim Herrmann (CSU) zur Informationsfreiheit: »Würde Bürger überfordern« (Open Knowledge Foundation Deutschland, 2018) lassen daran zweifeln, ob die Union Sinn und Zweck des IFG erkennen will. Denn beim IFG geht es (wie bei allen Informationsrechten) nicht nur um konkrete Auswirkungen, sondern auch um die Umstände, unter denen ein Sachverhalt entstanden ist.
3. Ein fader Beigeschmack
Dass ausgerechnet Philipp Amthor (CDU) in der Arbeitsgruppe »Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, Moderne Justiz« der Koalitionsverhandlungen die Unionsinitiative zur Abschaffung des IFG zur Sprache brachte, hat einen Beigeschmack kleinlicher politischer Revanche. Sowohl die Union mit dem »Scheuer-Maut-Skandal« (Michalski, 2025) als auch Amthor persönlich mit einem »[…] Interessenkonflikt zwischen politischem Amt […]« (Michalski, 2025) und Lobbytätigkeit haben mit der Aufdeckung ihrer Machenschaften durch IFG-Informationen negative politische & gesellschaftliche Konsequenzen erfahren.
Hinter wohlklingenden Floskeln wie »Entbürokratisierung« verbirgt sich allzu oft der handfeste politische Wille, zivilgesellschaftliche Interventionen zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. Doch damit nicht genug: Gerade der Schutz der digitalen Gesellschaft – der Datenschutz und seine Vertreter wie Aufsichtsbehörden und Datenschutzbeauftragte – steht unter dem unsachlichen Verdikt der »Bürokratie« im Zentrum des politisch motivierten Abbaus von Bürgerrechten.
Es ist übrigens kein Zufall, dass z.B. die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) beide Bürgerrechte in ihrem Titel trägt. Denn darin drückt sich die rechtsstaatliche Verpflichtung aus, dass sich der mächtige Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern durch Regeln beschränkt und sein Handeln vor ihnen offen legt. Daher ist die im Koalitionsvertrag implizierte Absicht einer Aufgabenerweiterung der BfDI
im »[…] Interesse der Wirtschaft […]« (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2025) als Enabler für eine wirtschaftliche Datennutzung zu fungieren, der eigentlichen Kontroll- und Aufsichtsfunktion zum Schutz der Bürgerrechte kaum angemessen.
CDU/CSU-Politikern fällt es offensichtlich immer noch schwer, die Durchsetzung von Bürgerrechten ohne Rücksicht auf die »Mächtigen« – in diesem Fall mächtige Wirtschaftsinteressen – zu denken. Diese gedankliche Abgrenzungsschwäche ist kaum verwunderlich. Verwechseln Unionspolitiker doch rhetorisch allzu oft den Begriff der Rechtsstaatlichkeit – die Beschränkung des Staates gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern durch das Recht – mit einer Härte des mächtigen Rechtsstaates gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern (Die volle Härte des Rechtsstaates). So auch Philipp Amthor, wenn
er – ganz Innenpolitiker – von einem »[…] Klima für einen starken Rechtsstaat und für einen harten Vollzug […]« (deutschlandfunk.de, 2018) spricht.
4. Deckmantel »Bürokratieabbau«
Es ist eine historische Ironie, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht, wie das Informationsfreiheitsgesetz oder datenschutzrechtliche Informationspflichten, von denjenigen, die an den Schalthebeln der politischen oder wirtschaftlichen Macht sitzen, als »Bürokratie« bezeichnet werden.
Schließlich war die »Herrschaft der Verwaltung« kennzeichnend für die Zeit der absolutistischen Polizeistaaten, in denen Verwaltungshandeln willkürlich, intransparent und eben nicht regelgebunden war. Aber damals wie heute ist »Bürokratie« verpönt. Und deshalb ist der Begriff das ideale politische Zauberwort, um unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung lästige Bürgerrechte abzuschaffen.
Die jahrelange diffamierende Assoziation der Rolle des betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit »Bürokratie« ist ein Beispiel für die Verwendung dieser politischen Zauberformel. Diese wurde bereits unter der letzten Großen Koalition insbesondere von der CDU/CSU betrieben.
Man ahnt es, in der Union hat sich seitdem wenig geändert, denn in den Koalitionsverhandlungen wollte man:
»[…] Rahmen eines »Sofortprogramms für den Bürokratierückbau« werden wir […] Verpflichtungen zur Bestellung […] abschaffen, insbesondere […] den betrieblichen Datenschutzbeauftragten (Streichung von § 38 BDSG) […]«
(Koalitionsverhandlungen CDU/CSU/SPD AG 9 – Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, Moderne Justiz, o. D.).
Der Koalitionsvertrag spricht nicht mehr konkret von einer Abschaffung des § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Es findet sich lediglich die nebulöse Absicht im »[…] Rahmen eines nationalen »Sofortprogramms für den Bürokratierückbau« werden wir […], insbesondere mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen, Verpflichtungen zur Bestellung von Betriebsbeauftragten abschaffen und den Schulungs-, Weiterbildungs- und Dokumentationsaufwand signifikant reduzieren.« (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2025).
Die Politik wäre gut beraten, sich die Überlegungen in Erinnerung zu rufen, die in Deutschland zur Verpflichtung zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten geführt haben (das BDSG orientiert sich hier an der Anzahl der Beschäftigten):
»Die Bundesregierung ist der Überzeugung, daß eine einheitliche Fremdkontrolle für den Anwendungsbereich dieses umfassenden Bundesgesetzes nur dann effektiv sein würde, wenn sie aus einer weitverzweigten Behördenorganisation bestünde. Dafür sieht die Bundesregierung jedoch keine Notwendigkeit. […], wenn auf der Grundlage des Prinzips der Selbstverantwortlichkeit ein System abgestufter Selbstkontrolle eingeführt wird.«
(Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung, Bundes-Datenschutzgesetz — BDSG, 1973)
Die damalige Bundesregierung hatte 1973 zutreffend erkannt, dass die Rechte der Bürger geschützt werden müssen, um zu verhindern, dass ihre personenbezogenen Daten durch informationstechnische Systeme missbraucht werden. Diese Feststellung gilt nach wie vor und mehr als fünf Jahrzehnte später umso mehr.
Das Mittel zur Überprüfung eines angemessenen Schutzes ist die Kontrolle (Selbstkontrolle des Unternehmens) durch betriebliche Datenschutzbeauftragte. Erstaunlicherweise handelt es sich dabei um ein Konzept, das die CDU/CSU auf ihrem 32. Parteitag noch selbst gefordert hatte: »[…] sowie die Methode der regulierten Selbstregulierung haben dabei Vorrang vor absoluten Verboten.« (Digitalcharta Innovationsplattform: D / Beschluss des 32. Parteitags der CDU Deutschland / Link eingefügt durch den Autor).
Eine Abschaffung des § 38 BDSG würde jedoch nicht dazu führen, dass die Unternehmen die datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht einhalten müssen, sondern nur dazu, dass ihnen wertvolles Know-how für eine rechtssichere Digitalisierung entzogen wird.
Wie die Bundesregierung bereits 1973 erkannte, wäre eine Kontrolle des Missbrauchsschutzes nur mit einer »weitverzweigten Behördenorganisation« (Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung, Bundes-Datenschutzgesetz — BDSG, 1973) möglich. Mit anderen Worten: Die vermeintliche Entbürokratisierung – oder vielmehr Reduzierung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten – der CDU/CSU würde zu mehr Aufsichtsbehörden – oder Verwaltungshandeln – führen, wenn der Schutz vor Missbrauch wirksam kontrolliert werden soll.
5. Überwachungsbürokratie
Wir kommen nicht umhin, den Zusammenhang von wirtschaftlichen Forderungen nach Bürokratieabbau und den Koalitionsvertrag zu betrachten. Der Lobbyverband Wirtschaftsrat der CDU vertritt die Sichtweise, dass die […] Datenschutzpolitik stärker aus wirtschaftlicher Perspektive gedacht werden […]« (Pressemitteilung Wirtschaftsrat der CDU, 2025) muss. Darüber hinaus vertreten die Wirtschaftslobbyisten die Ansicht, dass Regulierungen wie das »[…] bürokratische Monster Datenschutzgrundverordnung, sind Gift für die Wirtschaft.« (Pressemitteilung Wirtschaftsrat der CDU, 2019) sowie die Binsenweisheit »Bürokratie kostet Zeit und Geld.« (s.o.). Der Lobbyverband hat im öffentlichen Diskurs stets eine Sichtweise propagiert, dass Bürokratie mit Gesetzen gleichzusetzen ist, also unternehmensextern ist.
Die Politik übernimmt offenbar allzu gerne die Position der Wirtschaft, dass Datenschutz bzw. die DSGVO per se mit externer Bürokratie gleichzusetzen sei. Auch im Koalitionsvertrag setzt sich diese unsachliche Sichtweise rhetorisch fort, z. B. mit der Überschrift: »Datenschutz entbürokratisieren« (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2025). Der Eindruck, dass es sich bei Bürokratie immer um externe Bürokratie in Form von gesetzlichen Auflagen handelt, ist jedoch sachlich falsch.
Beschäftigte in Deutschland dürften ein Lied von der innerbetrieblichen Bürokratie singen können – meist Ausdruck von Mikromanagement und Kontrollwahn, Angst vor den eigenen Beschäftigten. Der Firmenpatriarch, der jede noch so kleine Rechnung persönlich freigibt, der Vorgesetzte, der sich E-Mails ausgedruckt vorlegen lässt oder – besonders beliebt – mehrstufige Freigabe- und Kontrollzyklen bei der Bestellung von Arbeitsmitteln, Dienstreisen etc. sind da noch vergleichsweise harmlose Beispiele.
Wie Kontrollwahn von Menschen in Bespitzelung umschlagen kann, zeigt exemplarisch der Fall des H&M Service Centers in Nürnberg. Die umfangreiche und heimliche Dokumentation privater und sensibler Informationen von Beschäftigten durch Vorgesetzte zur Erstellung eines »[…] Profils der Beschäftigten für Maßnahmen und Entscheidungen im Arbeitsverhältnis […]« (Pressemitteilung HmbBfDI, 2020) führte zu Recht zu einer Geldbuße von 35 Millionen Euro. Neben einem ausgewachsenen Datenschutzskandal ist die Erfassung von 60 Gigabyte privater Daten ein Paradebeispiel für innerbetriebliche Überwachungsbürokratie. Diese Überwachungsdaten und -profile wurden schließlich verwaltet, gesichtet und aktualisiert. H&M ist kein Einzelfall, wie die folgenden Beispiele zeigen:
- Die Deutsche Bahn hat über mehrere Jahre hinweg 173.000 Mitarbeiter, aber auch Ehepartner, bespitzelt, um Korruption aufzudecken.
- Die UnicreditServices, die im Namen der IT-Sicherheit Beschäftigte unter Generalverdacht stellt, indem das Unternehmen »[…] alle erdenklichen Daten gesammelt, über mehrere Jahre gespeichert und teils ausgewertet.« (Wolfangel, 2021) und eine »[…] Armada an Überwachungssoftware ausgerollt. […] (Wolfangel, 2021) hat. Siehe Artikel von Eva Wolfangel hier und hier.
Die Verwaltung der internen Überwachungsbürokratie in diesen Beispielen – die übrigens in den überwiegenden Fällen unbescholtene Beschäftigte überwachte – erfordert Aufwand und Ressourcen. Mit anderen Worten: Überwachungsbürokratie kostet Zeit und Geld. Angesichts des Aufwands, der mit der internen Überwachung von Beschäftigten verbunden ist, ist es schwer zu verstehen, warum es für Unternehmen eine unangemessene Herausforderung sein sollte, ihren Datenschutzverpflichtungen nachzukommen.
Geradezu grotesk wird es, wenn man genauer hinschaut und die Überwachungsbürokratie in einen anderen Kontext stellt: Überwachungssoftware berücksichtigt nämlich als »unerwünschtes Verhalten« für ihren Risikowert: Überstunden, Arbeit nach Feierabend oder in der Nacht. Während also der Wirtschaftsrat der CDU Lobbyarbeit für die Flexibilisierung der Arbeitszeiten betreibt, werden in Deutschland Beschäftigte für genau diese »flexiblen Arbeitszeiten« von Überwachungssoftware als Risiko eingestuft und unter Umständen sogar sanktioniert.
6. Kontrolle
Wie wir gesehen haben, geht es bei den von uns thematisierten Vorhaben im Koalitionsvertrag keineswegs um Bürokratieabbau. Es geht vielmehr um Kontrolle. Denn die Koalition will »Vertrauen statt Regulierung und Kontrolle« (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2025). Und hier muss man Markus Söder (CSU) zitieren: »Zurück vor 2015« – das Zitat steht in einem anderen Kontext bei der Pressekonferenz von Union & SPD und ist dennoch entlarvend. Denn durch den Koalitionsvertrag weht tatsächlich ein Hauch von vor 2015, wenn es um die Durchsetzung von Bürgerrechten geht: Unternehmen soll mehr vertraut – und weniger kontrolliert werden – als hätte das letzte Jahrzehnt nicht gezeigt, dass wir Unternehmen unsere Grundrechte leider nicht anvertrauen können.
Die »Mächtigen« – ob in Politik oder Wirtschaft – wollen sich weniger rechtfertigen und weniger von der Zivilgesellschaft kontrollieren lassen. So ist der Vorstoß von Philipp Amthor zur Abschaffung des IFG zu verstehen. So ist auch der Vorstoß der Union zu verstehen, den betrieblichen Datenschutzbeauftragten abzuschaffen (Streichung des § 38 BDSG). Dazu muss man verstehen, dass das IFG und die Datenschutzbeauftragten Mittel zum Zweck sind – es geht um die indirekte Kontrolle, ob die Grundrechte auch geschützt werden. Indem man das Mittel als Bürokratie diffamiert, greift man zwar nicht direkt die Bürgerrechte an – niemand in Politik und Wirtschaft würde öffentlich erklären, er wolle »[…] en passant die Transparenz abschaffen […]« (Bachran & ZDFheute, 2025). Die Wirkung ist aber dieselbe.
Wer sich nun fragt, wo die SPD bei all dem bleibt. Was gäbe es über sie zu schreiben? Wo hat sie die Zivilgesellschaft im Digitalen gestärkt? Wo ist sie dem Datenschutz-Bashing entgegengetreten? Vielleicht werden wir es in der Gesetzgebung noch sehen, wer weiß.
Fest steht jedenfalls: Mit dem Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger ist es nicht weit her – sie sollen überwacht, unter Generalverdacht gestellt werden. Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen, biometrische Fahndung im Internet, Videoüberwachung mit Gesichtserkennung etc. stehen im Koalitionsvertrag. Das ist letztlich ein Rückfall in die Zeit, als gesellschaftliche Kontrolle noch stärker hierarchisch funktionierte: von oben nach unten. Für die weitere Diskussion sollten wir uns folgende ernüchternde Erkenntnis vor Augen halten: Kontrolle wird nur dann rhetorisch als Bürokratie bezeichnet, wenn Wirtschaft und Politik kontrolliert werden.
,regionOfInterest=(1148,807)&hash=f56a8b955ad9f1c8bf3c88ef72c0f85966e37a70651cb94012fa71f2da45bc9f#)








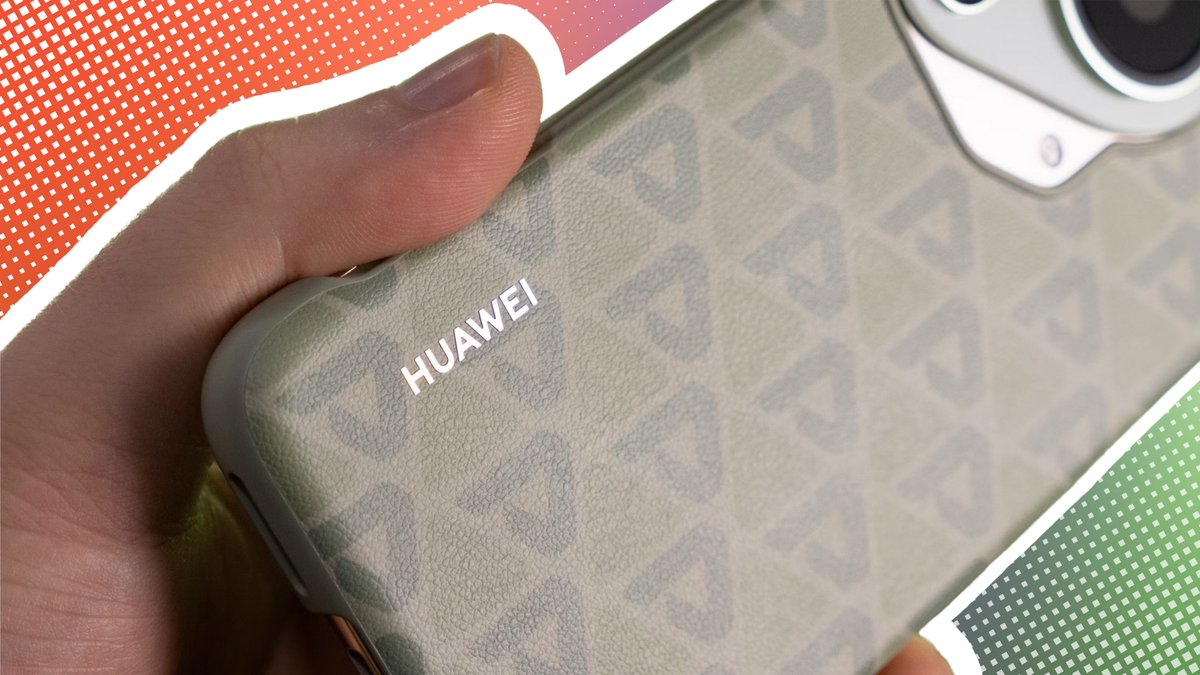











































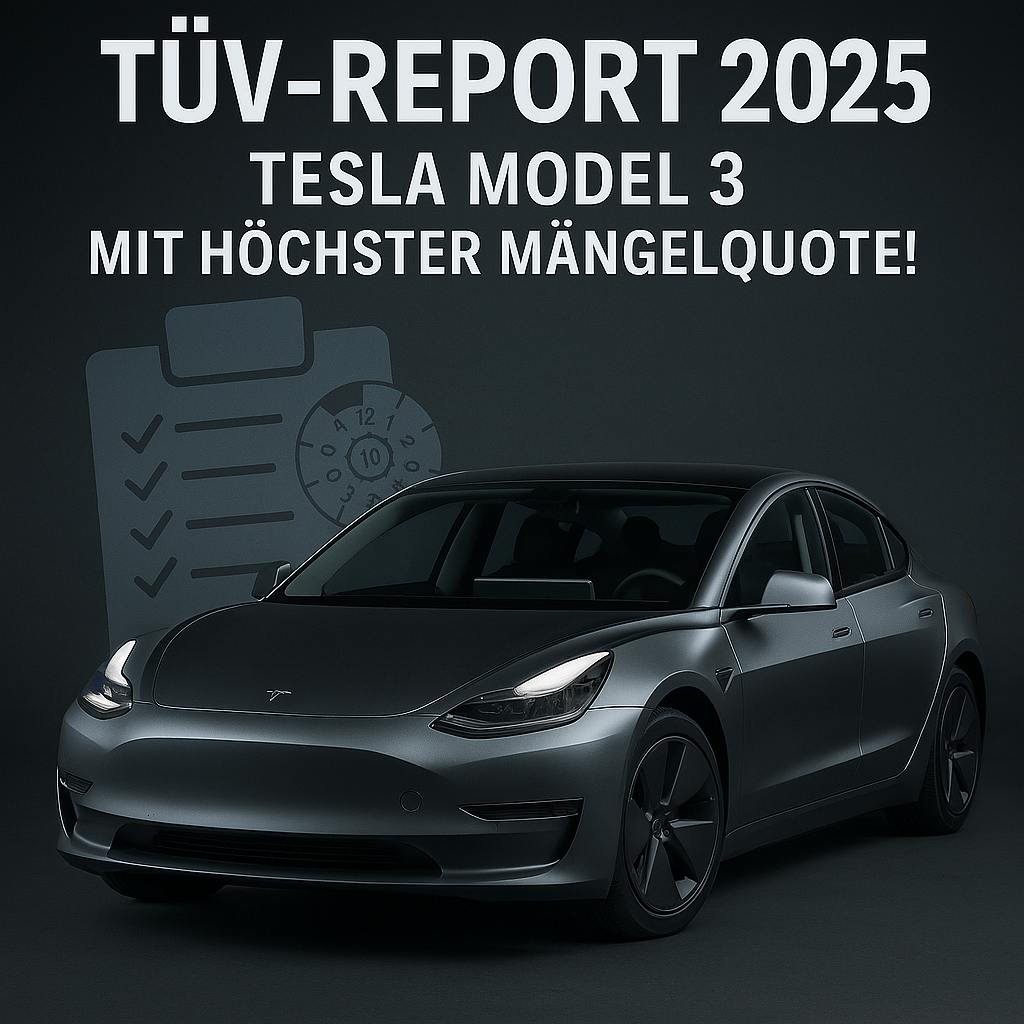
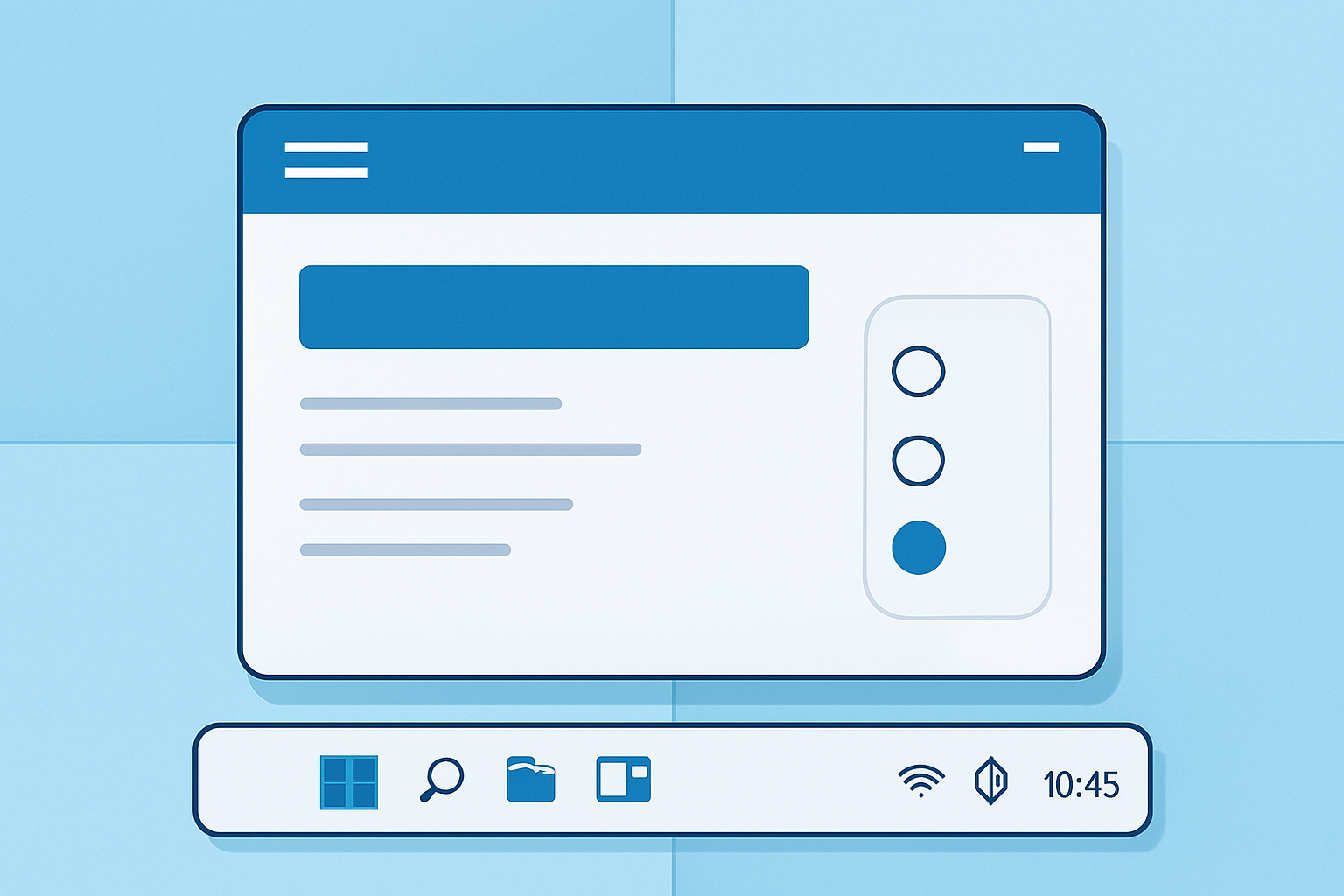










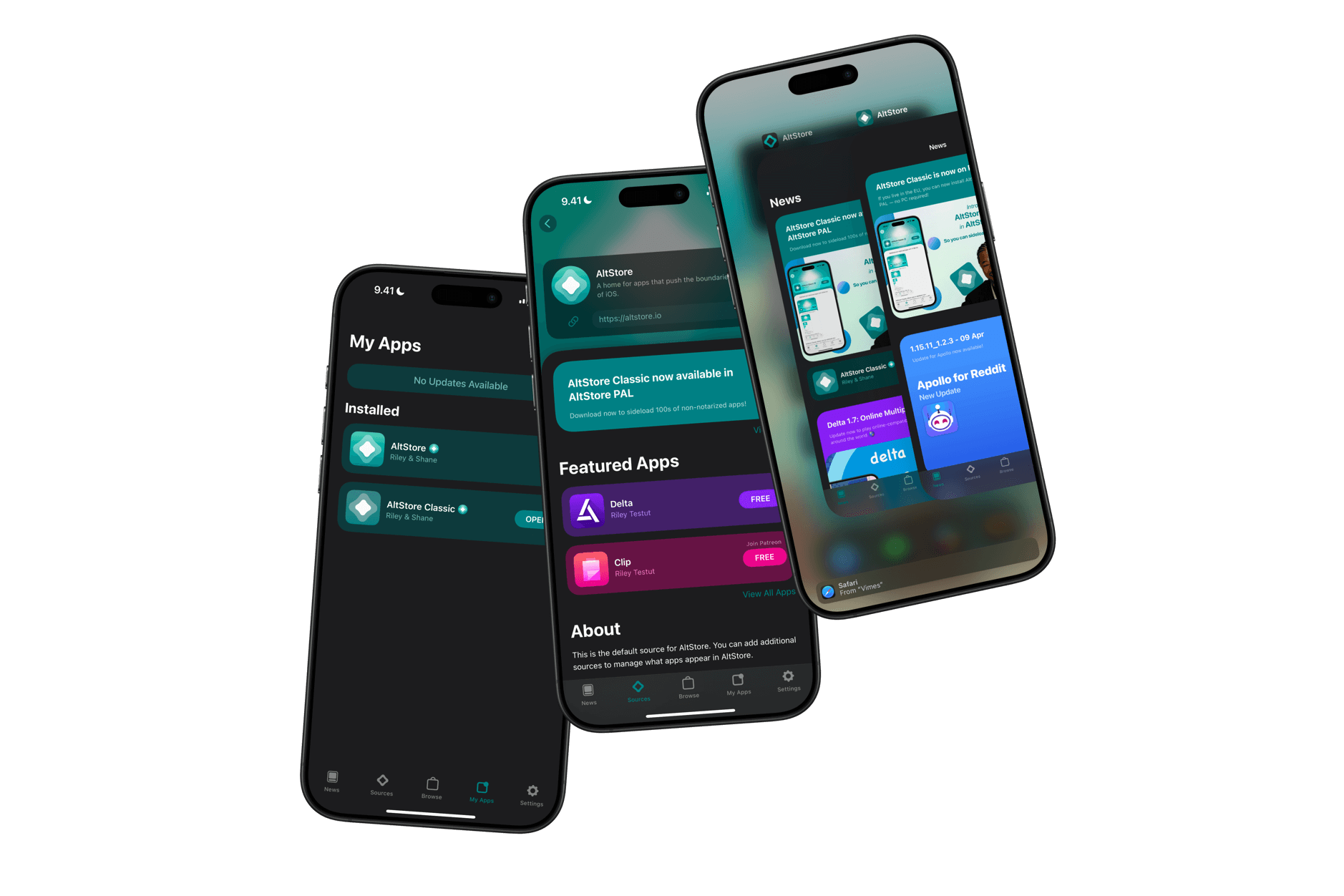









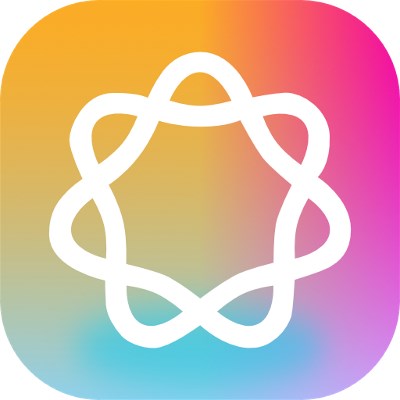
















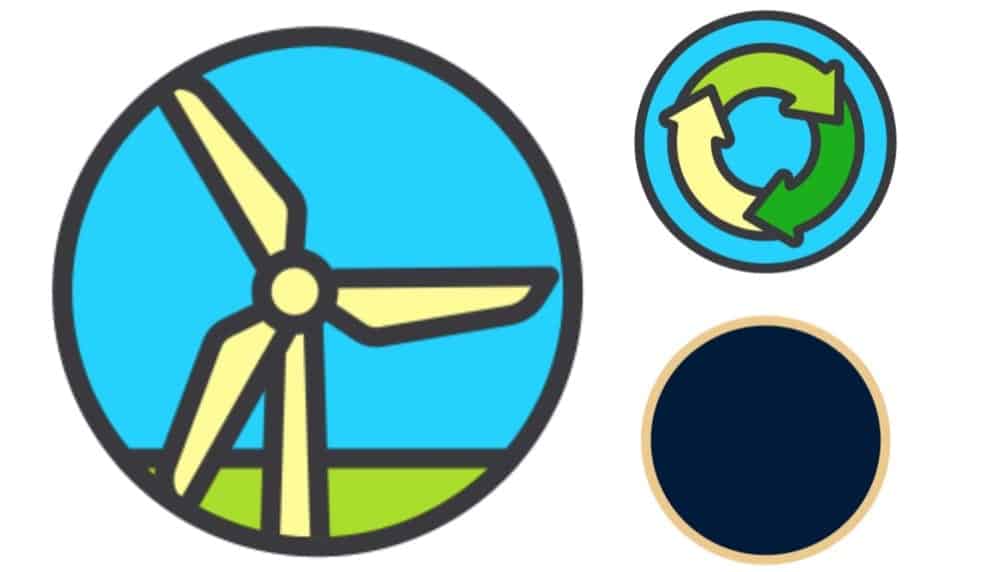









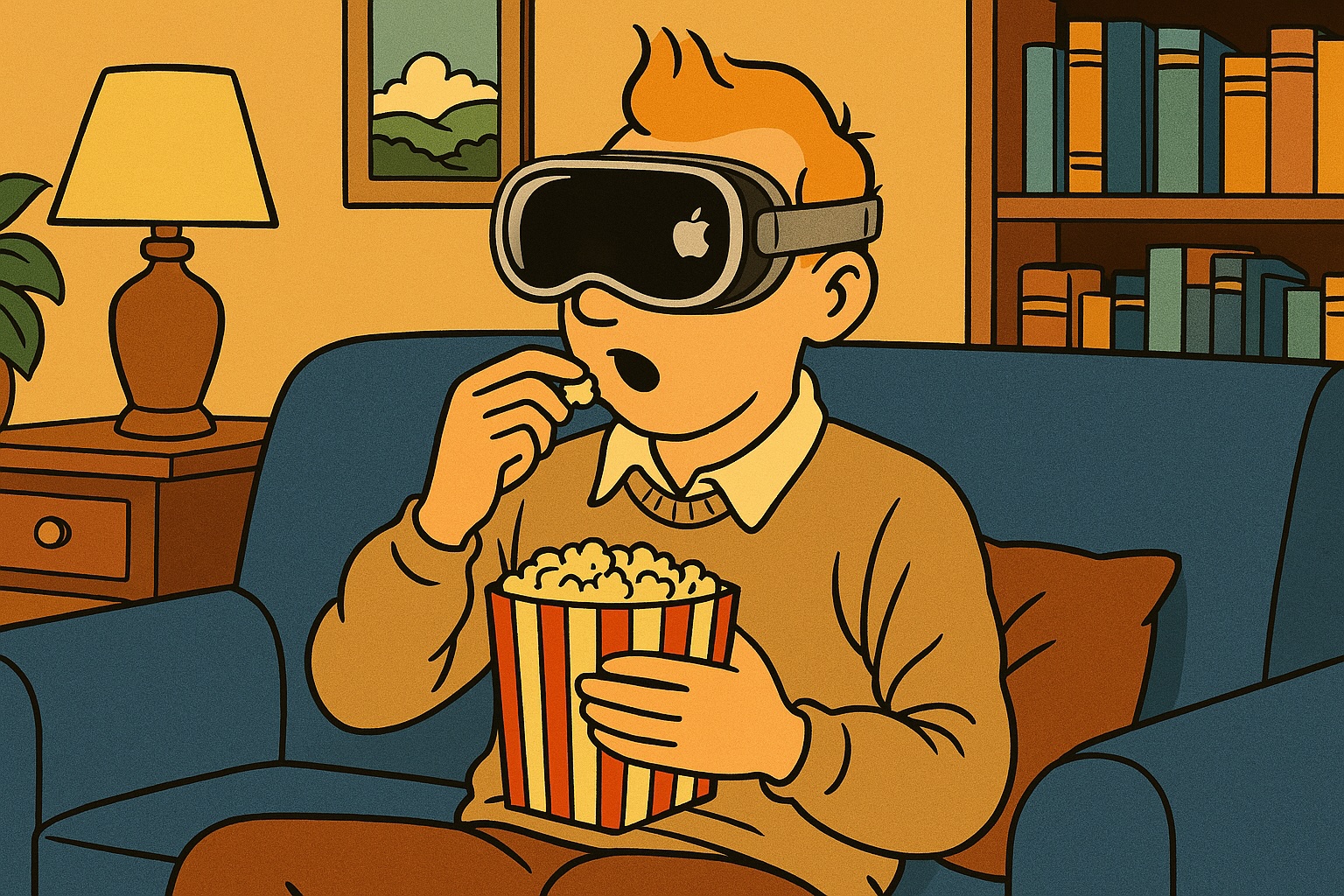




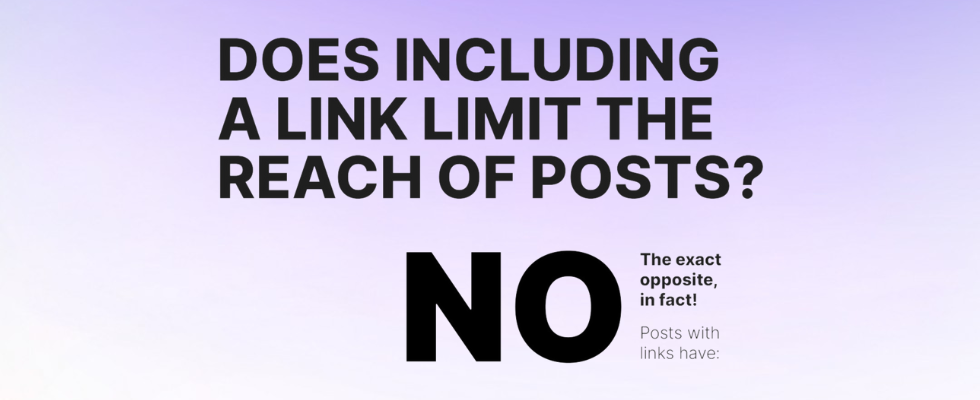

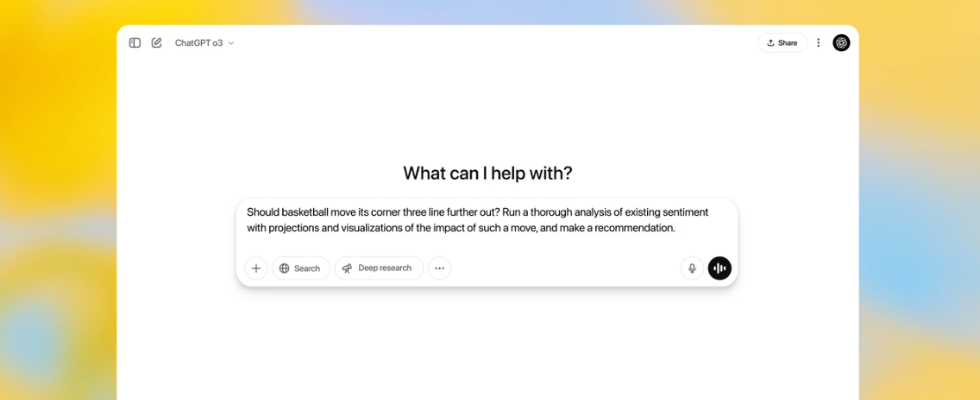
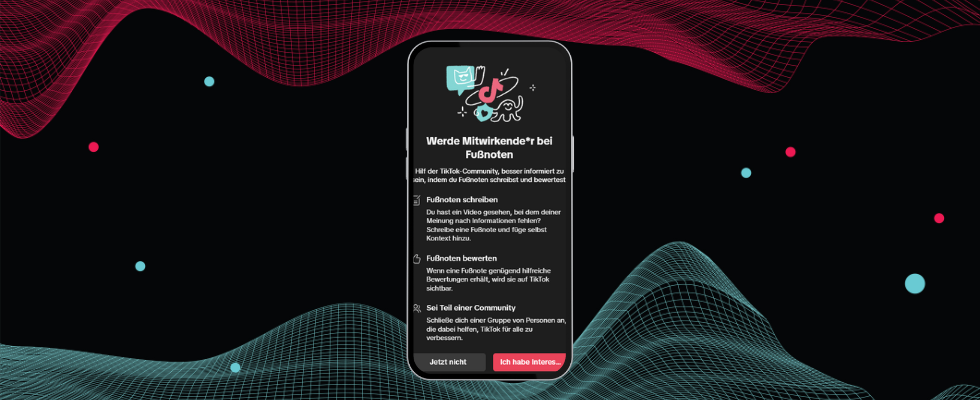



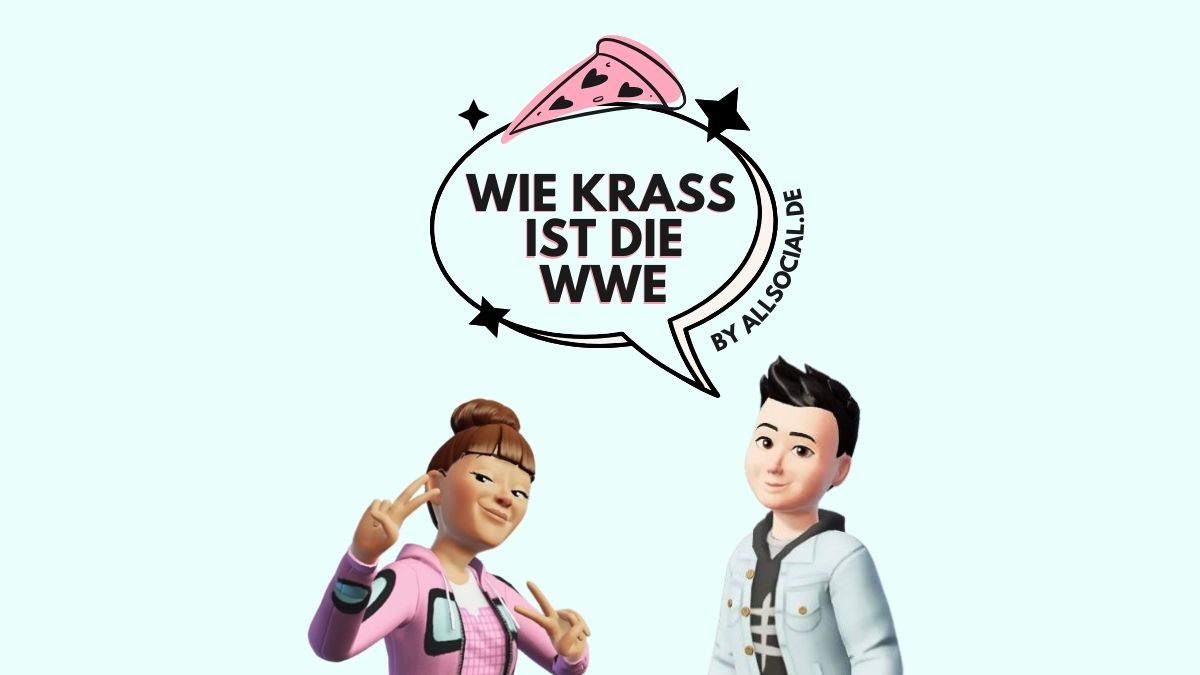
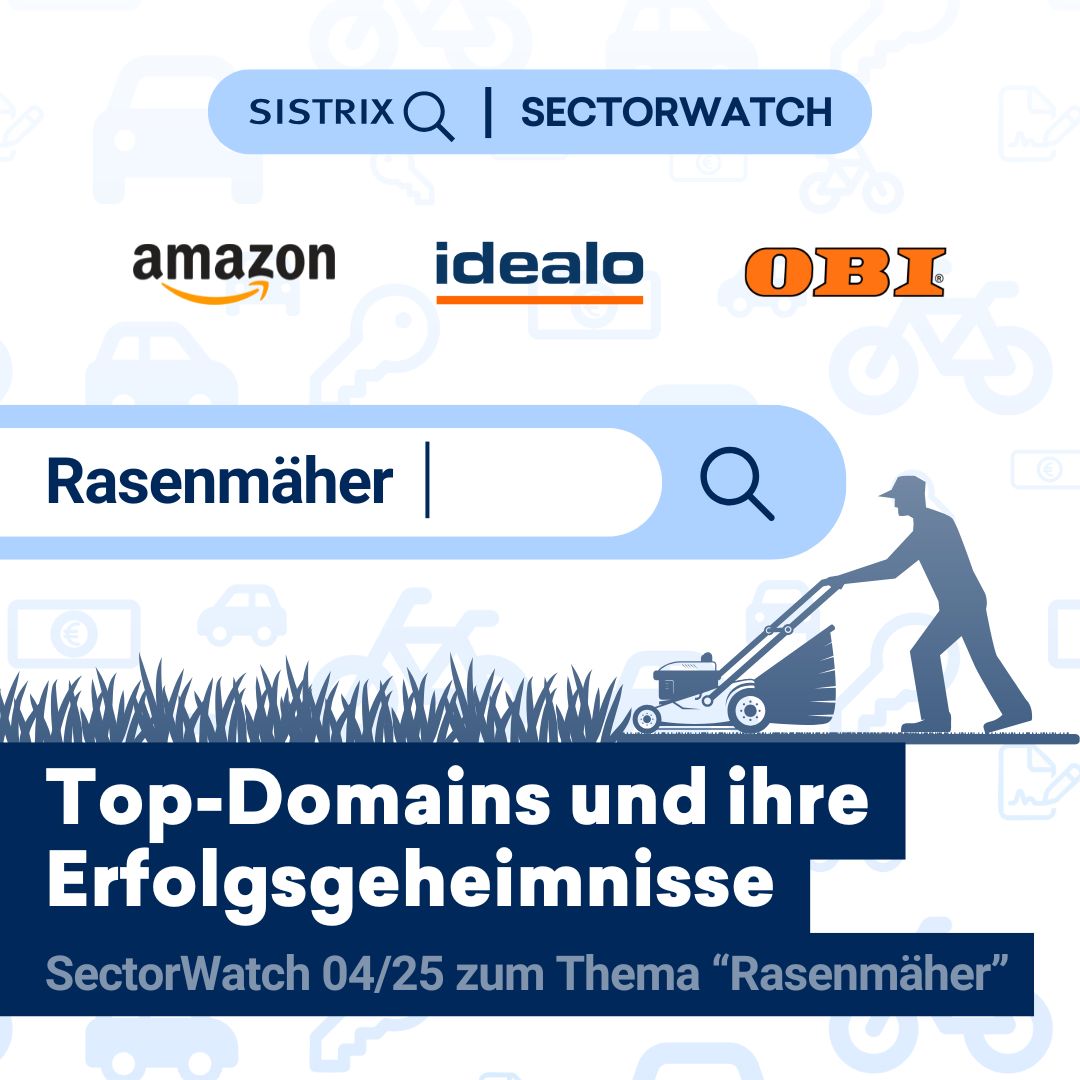
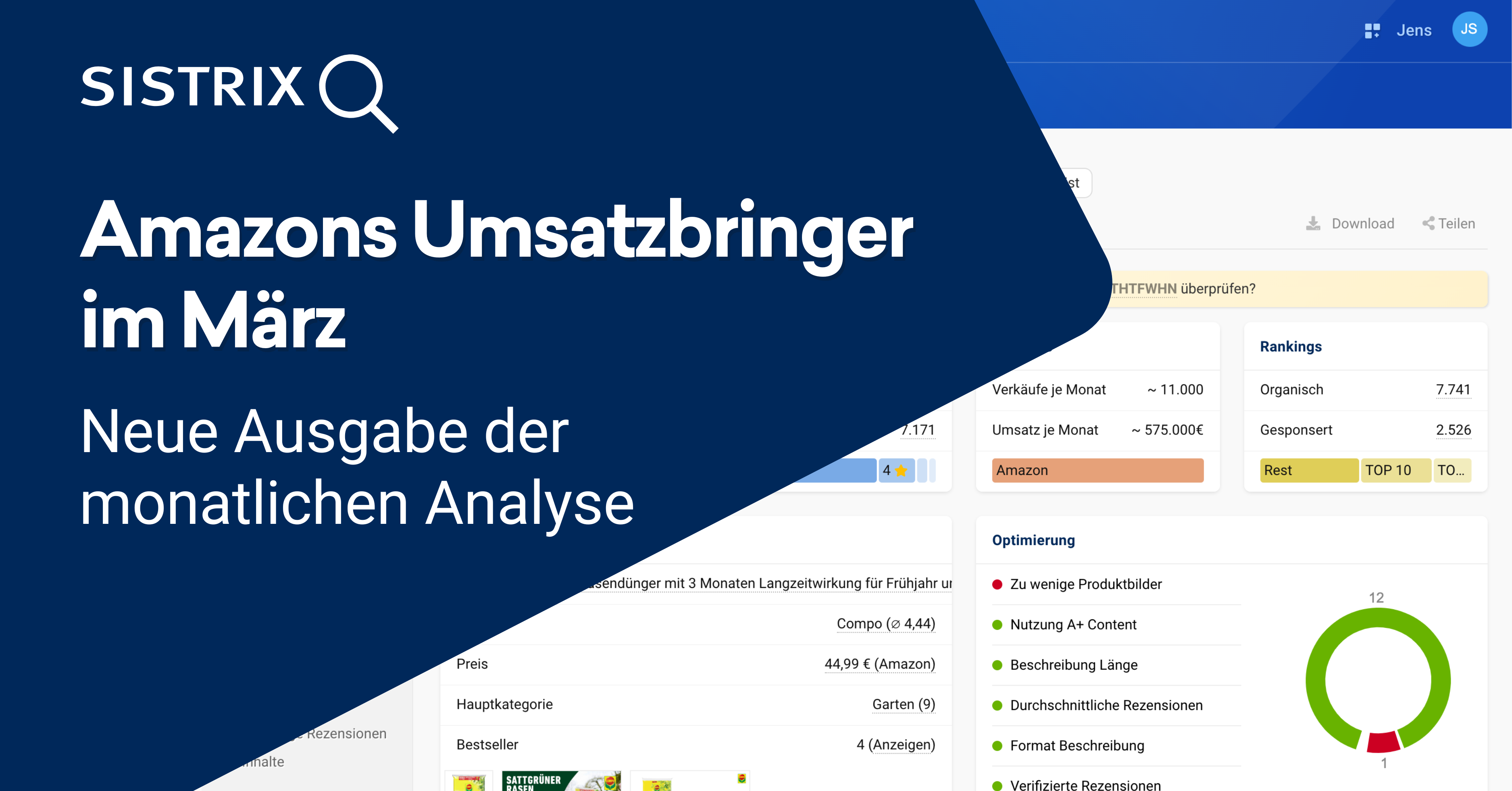

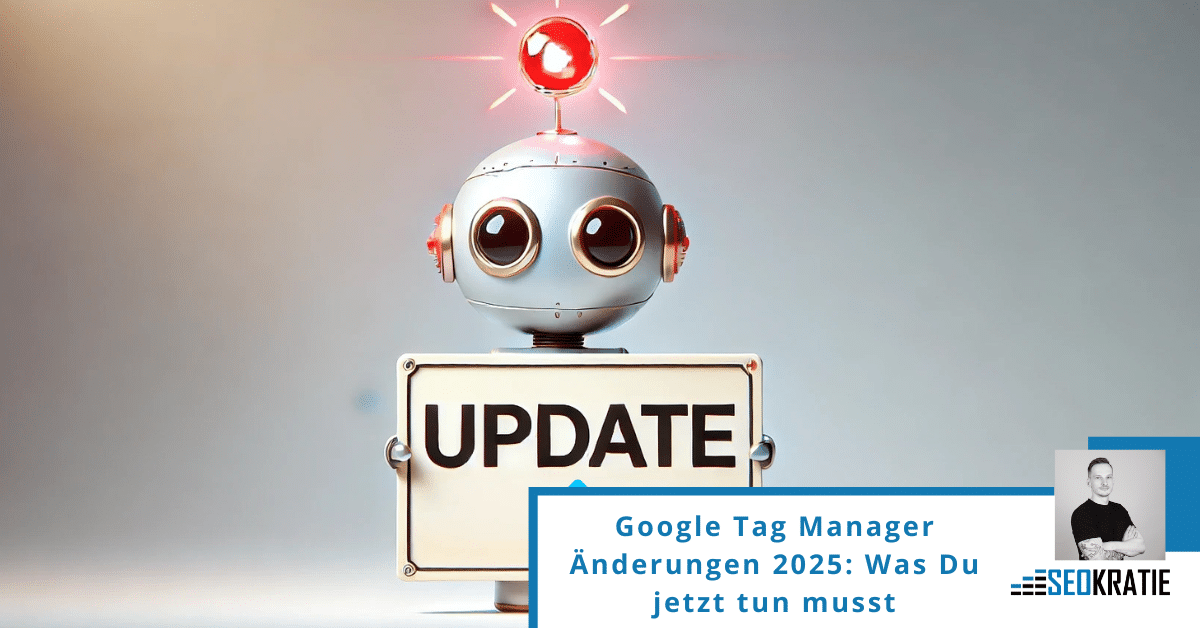




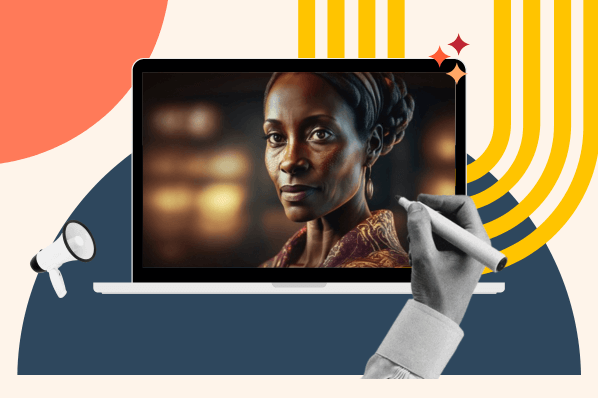







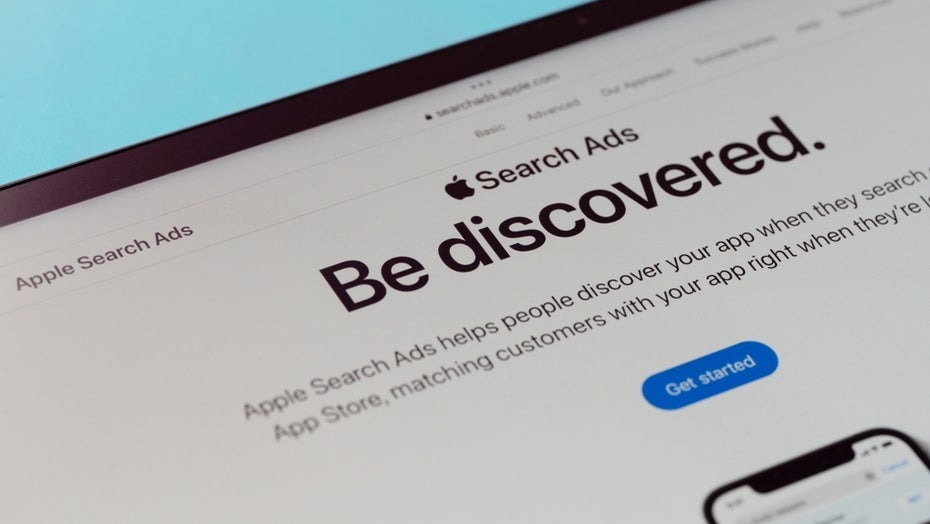











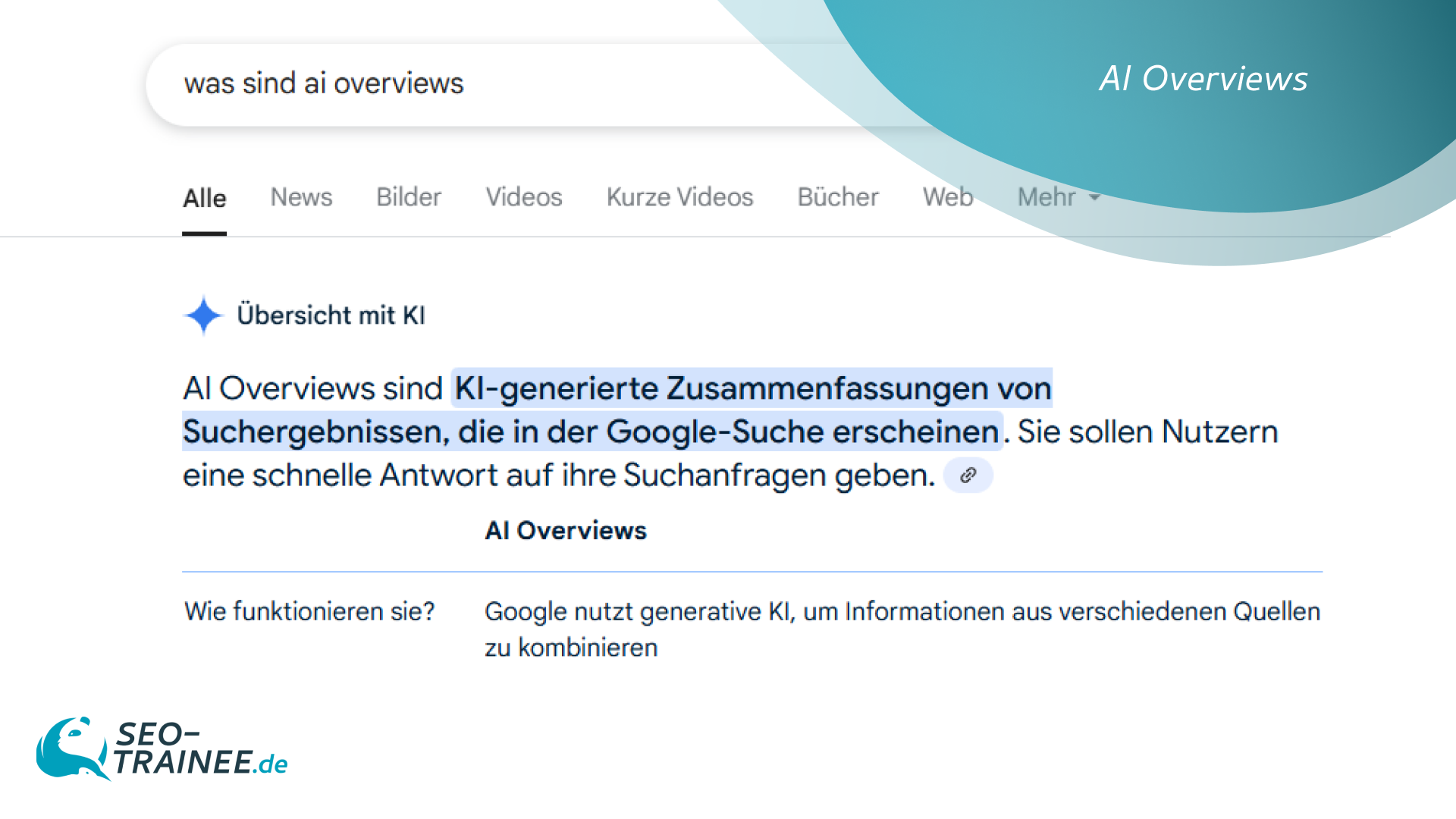

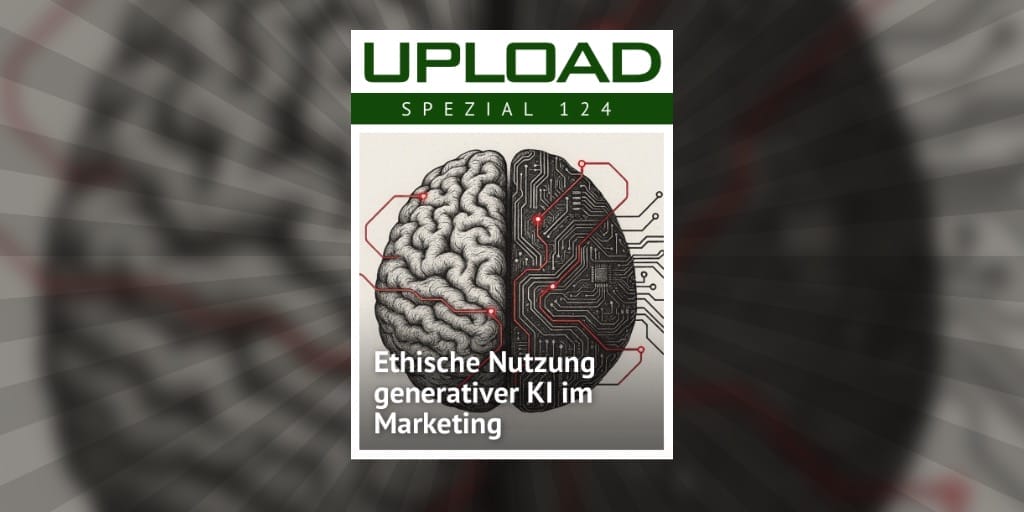












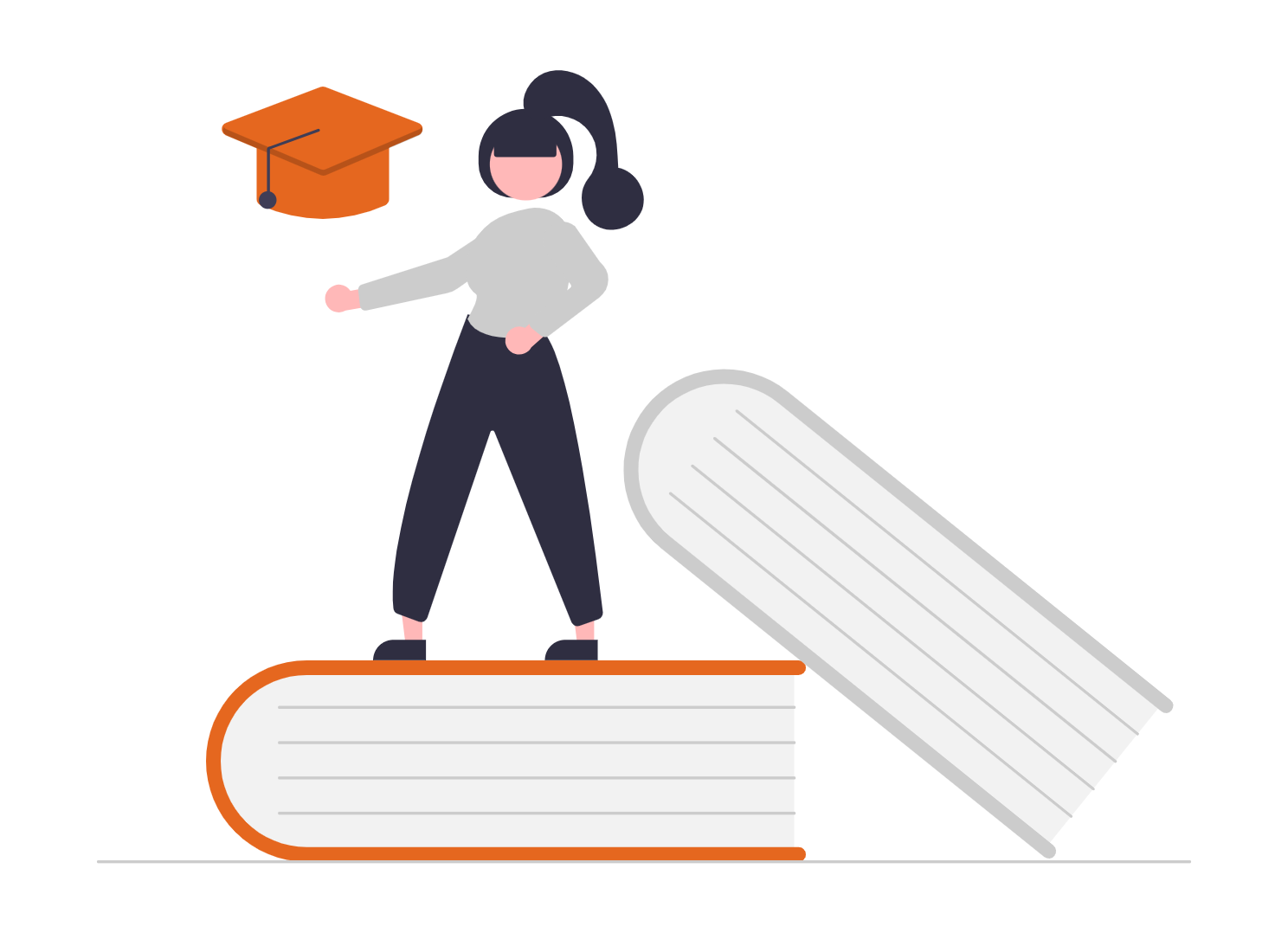




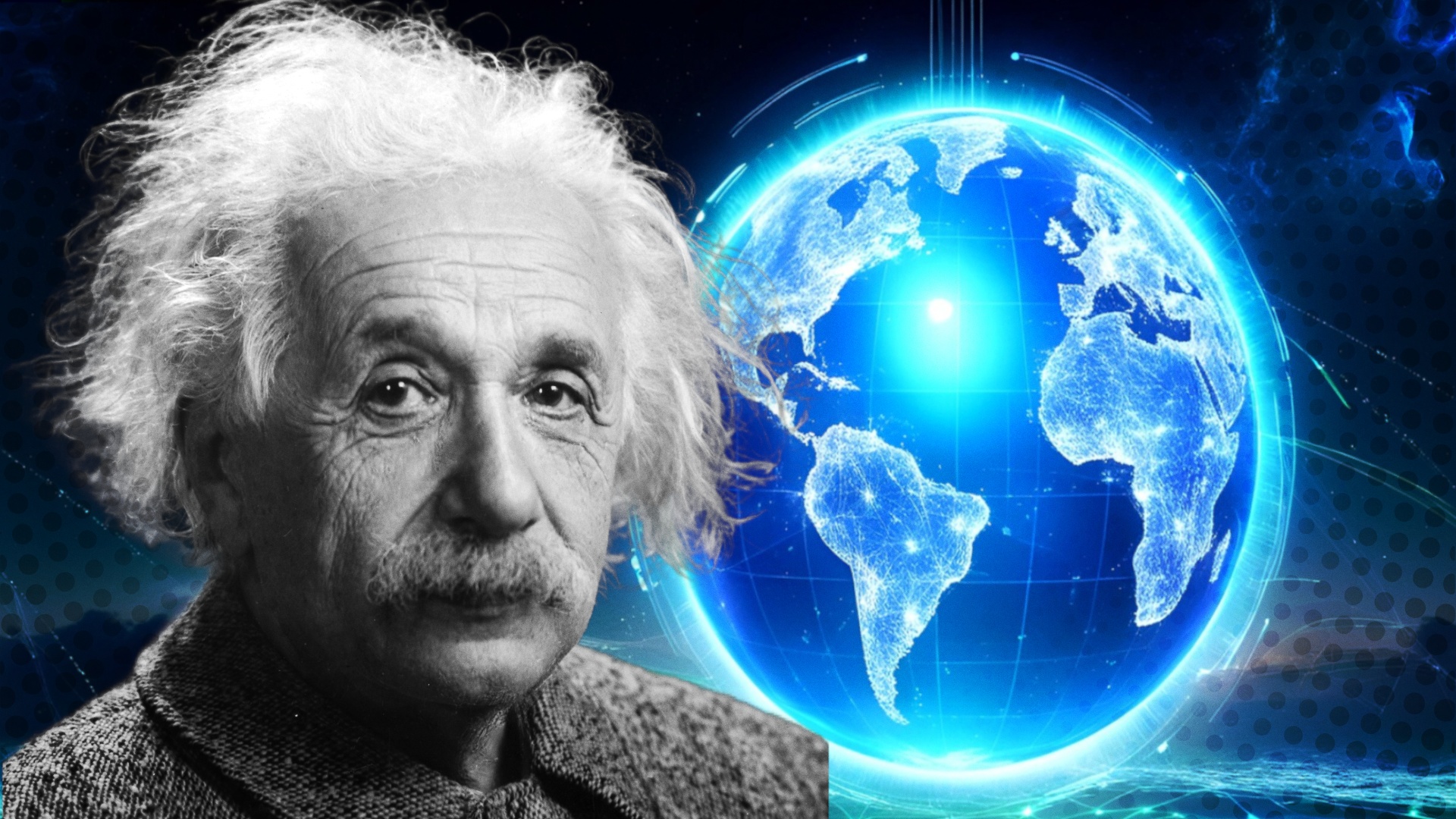


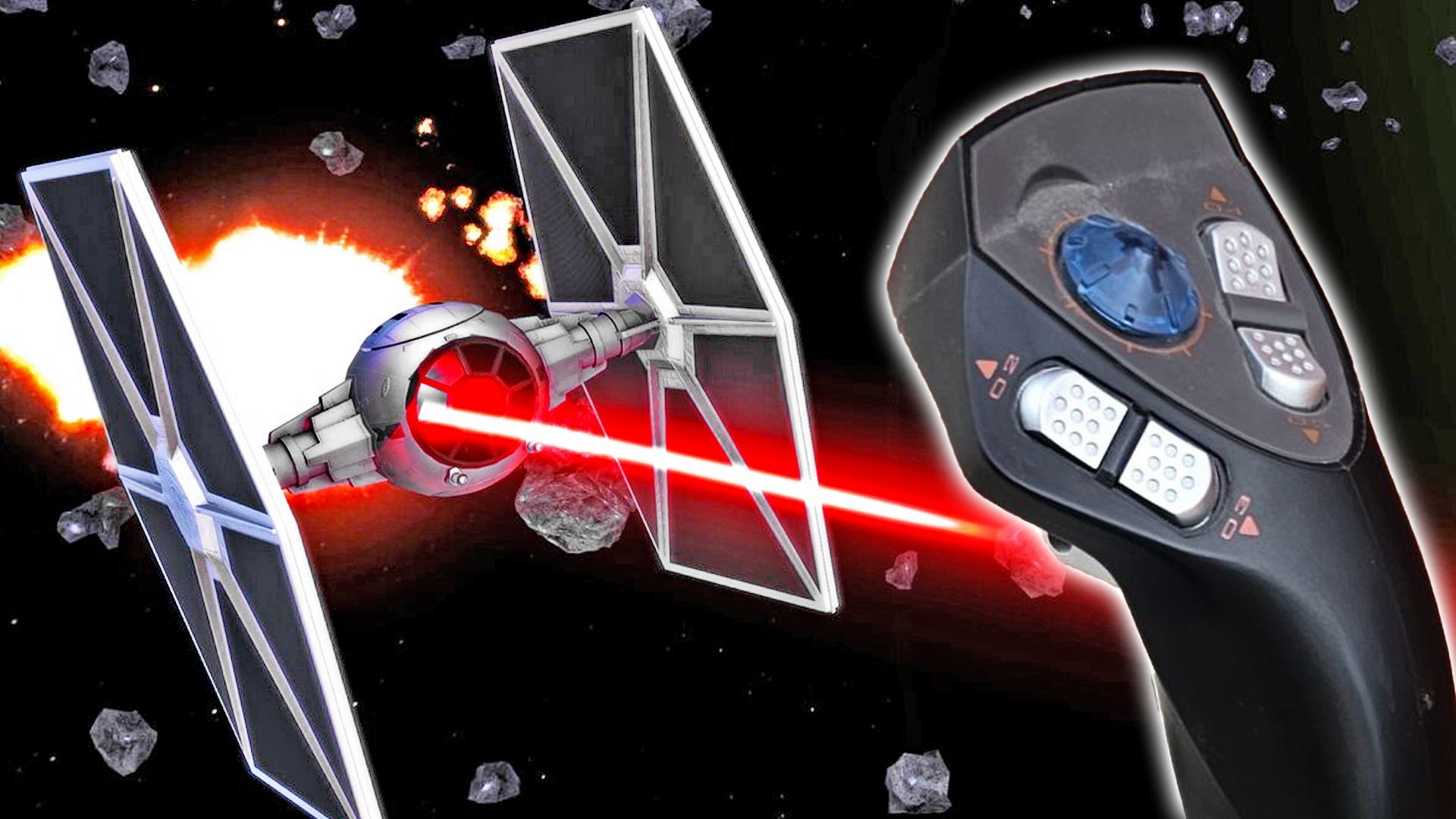

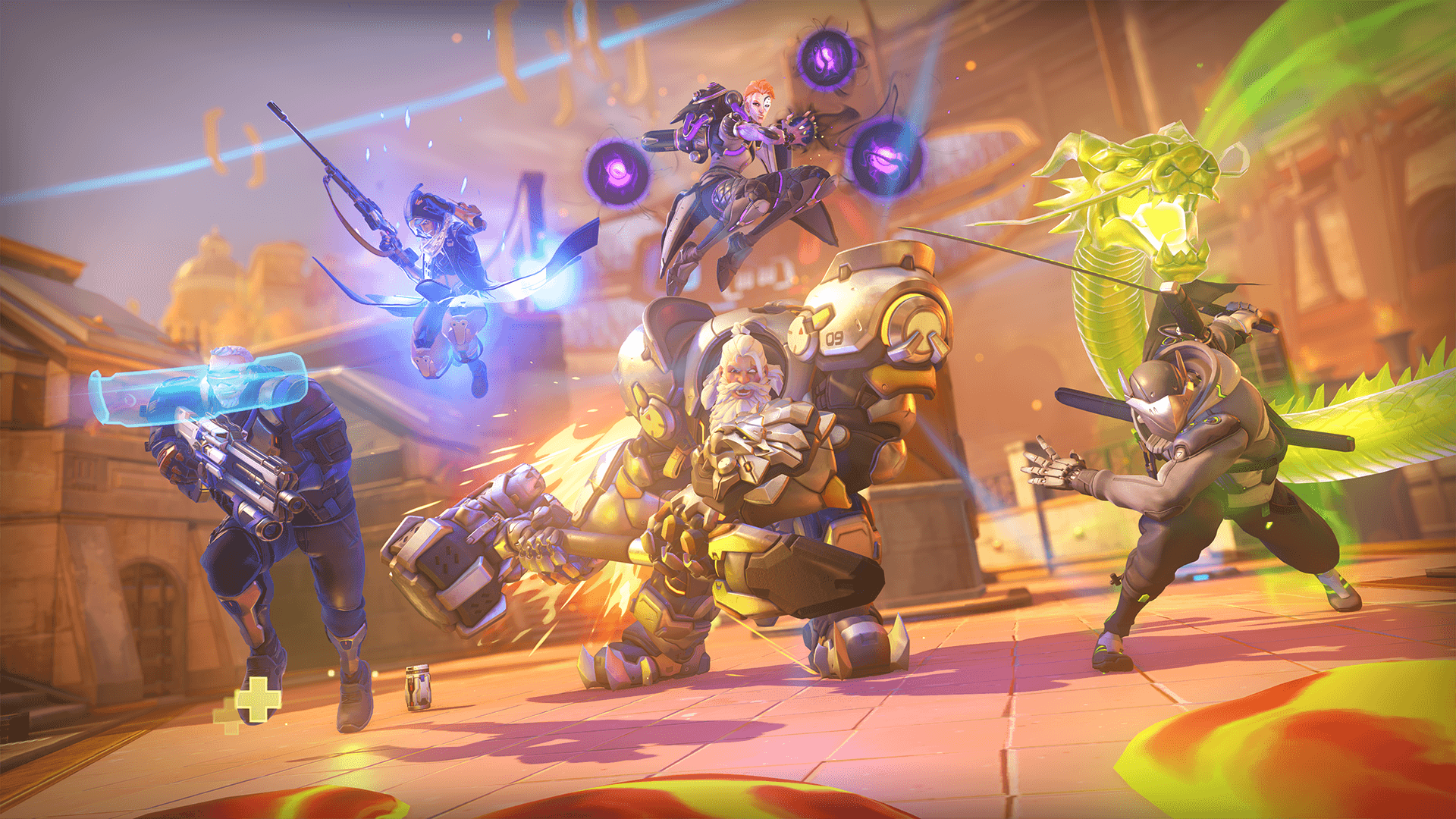

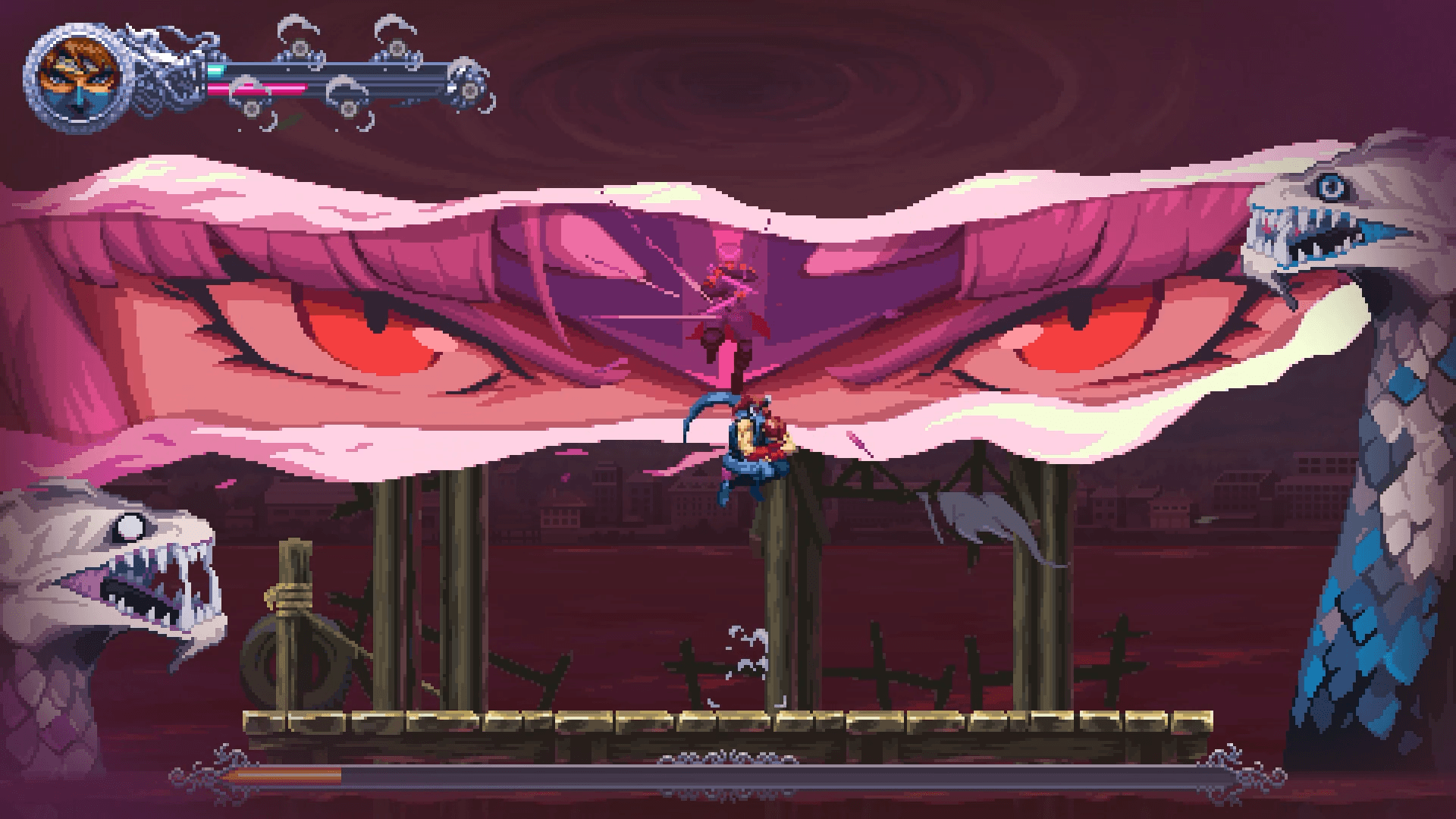

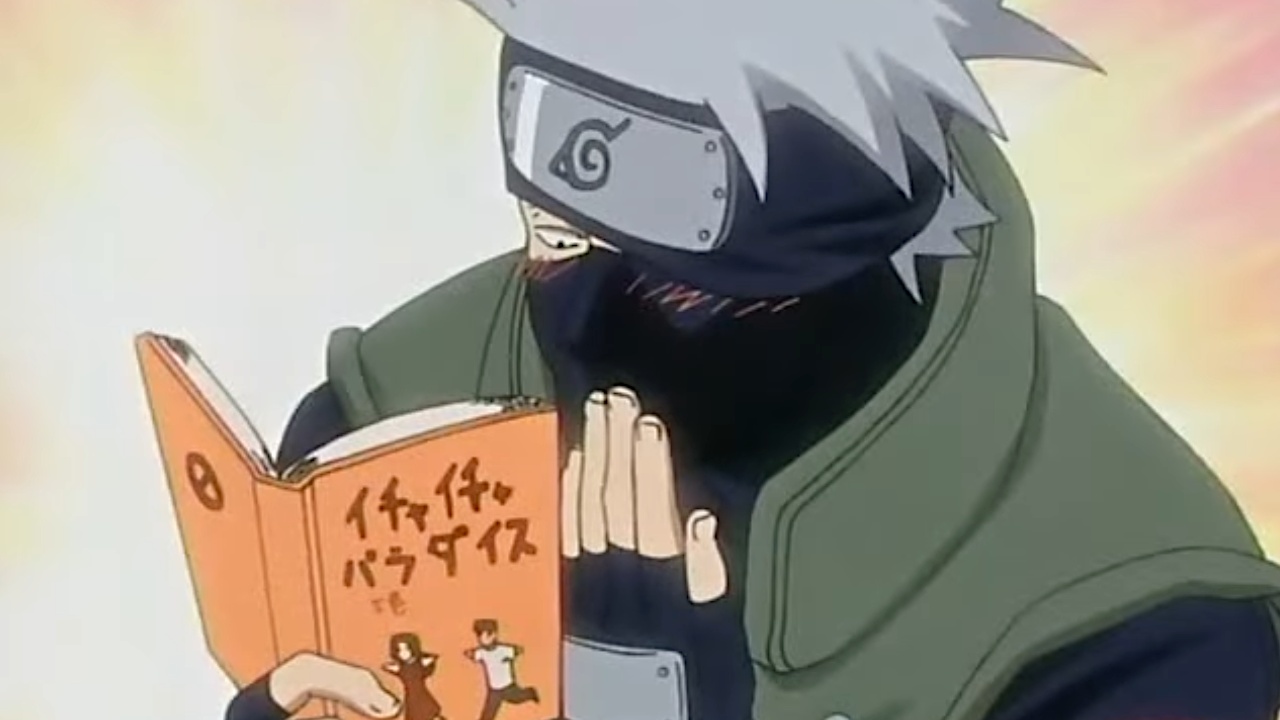
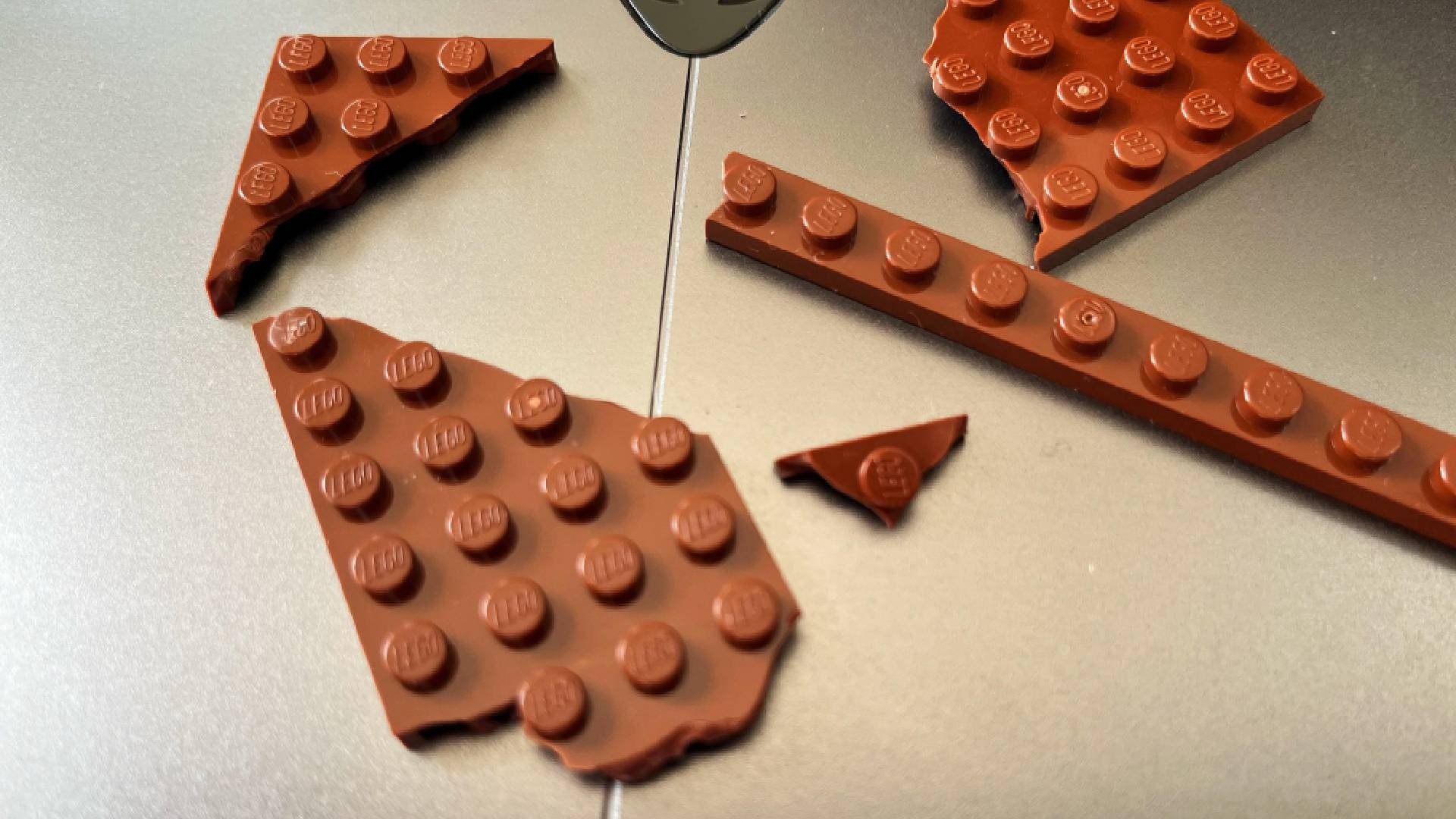












































:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/57/ee/57eedd11c2043e71aadc1828a06e3063/0124267466v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/b5/c4b5f9ba2c6a913088a84b641e36de3f/0124266663v2.jpeg?#)