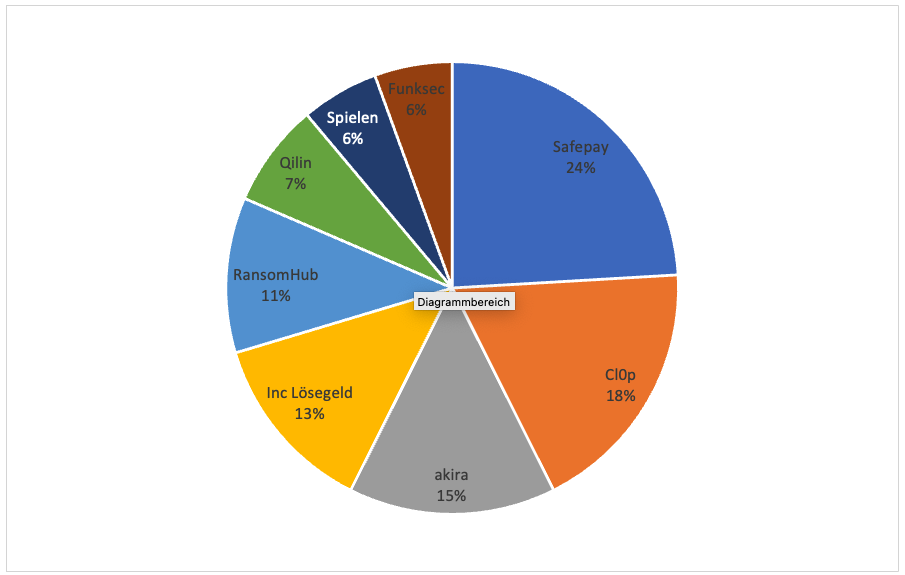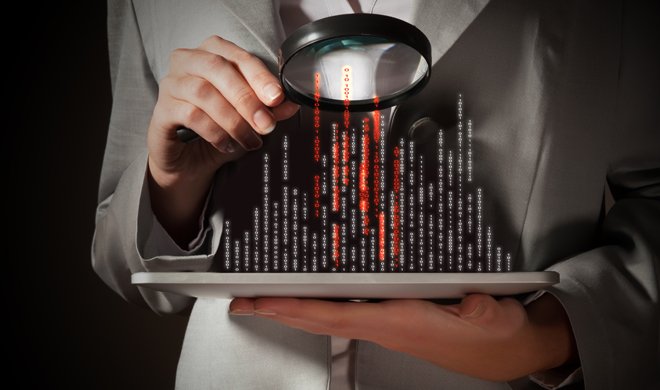Bisherige Speicherdauer von Auskunfteien vs. DSGVO
Viele Verbraucher sind von Zahlungsstörungs- bzw. Negativ-Einträgen bei Auskunfteien betroffen und werden diese trotz Ausgleich der zugrundeliegenden Forderungen aufgrund der vorherrschenden langjährigen Speicherdauer der Auskunfteien regelmäßig über Jahre hinweg nicht los – mit fatalen Folgen bei der Wohnungssuche und Vertragsschlüssen. Diese Speicherdauerpraxis hält das OLG Köln – wie nachfolgend dargestellt – für DSGVO-widrig. Ausgangslage: Keine sofortige […]

Viele Verbraucher sind von Zahlungsstörungs- bzw. Negativ-Einträgen bei Auskunfteien betroffen und werden diese trotz Ausgleich der zugrundeliegenden Forderungen aufgrund der vorherrschenden langjährigen Speicherdauer der Auskunfteien regelmäßig über Jahre hinweg nicht los – mit fatalen Folgen bei der Wohnungssuche und Vertragsschlüssen. Diese Speicherdauerpraxis hält das OLG Köln – wie nachfolgend dargestellt – für DSGVO-widrig.
Ausgangslage: Keine sofortige Löschung von erledigten Zahlungsstörungen
Gegenstand des Urteils des OLG Köln vom 10.04.2025 (Az. 15 U 249/24) war im Groben folgender Sachverhalt: Die Beklagte betreibt eine Wirtschaftsauskunftei. Sie speicherte Daten zu Forderungen gegenüber dem Kläger bzw. bei ihm aufgetretene Zahlungsstörungen und hielt diese für ihre Kunden zum Abruf bereit. Nach Bezahlung dieser Forderungen forderte der Kläger sie zunächst auch im Klageantrag auf, die Einträge zu diesen Zahlungsstörungen bzw. Daten zu diesen getilgten Forderungen zu löschen. Dies lehnte die Beklagte unter Verweis darauf ab, dass sie diese erst drei Jahre nach Tilgung der jeweiligen Forderung löscht.
Bis auf die Daten zu einer im Dezember 2022 beglichenen Forderung löschte sie die Daten im Laufe des Rechtsstreits auch erst drei Jahre nach Bezahlung – die Daten zu der im Dezember 2022 ausgeglichenen Forderung hingegen bereits ca. 2 Jahre nach Zahlungseingang aufgrund einer zwischenzeitlich Geltung erlangten verbandsinternen Verhaltensregelung, welche vom Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit genehmigt wurde.
Seinen ursprünglich auf Löschung der Einträge gerichteten Klageantrag änderte der Kläger angesichts der im Laufe des Rechtsstreits erfolgten Eintragslöschungen und Erledigungserklärungen auf Zahlung eines immateriellen Schadensersatzes ab und nahm dabei Bezug auf die zunächst verweigerte Löschung und die Folgen dieser Verweigerung für ihn.
Daher musste das OLG Köln auch noch zur Rechtmäßigkeit der Speicherdauer ausführen.
Löschung zumindest nach Tilgungsnachweis
Das OLG Köln entschied entgegen der 1. Instanz (und der grundsätzlichen Rechtsprechung mehrerer anderer Oberlandesgerichte), dass die Auskunftei nicht erst nach zwei bzw. drei Jahren, sondern sofort nach Erbringung des Nachweises des Forderungsausgleiches durch den Kläger die Speicherung hätte beenden und die Daten löschen müssen, weil dadurch die in Art. 6 Abs.1 DSGVO enthaltenen Bedingungen für eine fortdauernde Speicherung nicht länger erfüllt waren.
Es begründete seine Ansicht insbesondere damit, dass bei einer Abwägung der einander gegenüberstehenden Rechte und Interessen gem. Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO mangels einer gesetzlichen Vorschrift der für Wirtschaftsauskunfteien ausschlaggebenden Speicherfristen angesichts der mit dem (staatlichen) Schuldnerverzeichnis vergleichbaren Situation die Wertung des § 882e Abs. 3 Nr. 1 ZPO (Löschung einer Eintragung im staatlichen Schuldnerverzeichnis) maßgeblich berücksichtigt werden muss.
Diese beinhaltet übertragen auf diesen Fall, dass die Beklagte die Zahlungsstörungseinträge des Klägers nach Nachweis der vollständigen Befriedigung der jeweiligen Gläubiger hätte löschen müssen.
Dass die genannte verbandsinterne Verhaltensregelung eine bestimmte Speicherdauer vorsieht, sei unerheblich, da Verhaltensregeln im Sinne des Art. 40 DSGVO wie vorliegend dann nicht bei der Abwägung im Rahmen von Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO berücksichtigt werden könnten, wenn sie zu einer anderen Beurteilung als der nach Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO führen würden.
Das OLG Köln sprach dem Kläger aufgrund der mit der Speicherung bzw. Datenbereitstellung einhergehenden Verstöße der Beklagten gegen die DSGVO und deren jedenfalls rufschädigender Auswirkung im konkreten Fall u. a. 500,00 € als ausreichenden immateriellen Schadensersatz und 540,50 € an außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten zu, zzgl. Zinsen.
Zitterpartie für Auskunfteien
Es bleibt abzuwarten, ob die Beklagte gegen das Urteil vorgehen und sich in der Frage der rechtmäßigen Speicherdauer von Negativ-Einträgen über diesen Schritt eine einheitliche Rechtsprechung bilden können wird.
Sollten die Auskunfteien pauschale Speicherfristen von z. B. drei Jahren nach getilgter Forderung vorsehen bzw. Einträge über Zahlungsstörungen nicht unmittelbar nach dem Nachweis der getilgten Forderung löschen und sich die Rechtsansicht des OLG Köln durchsetzen, könnte sie dieses Vorgehen hinsichtlich der Vielzahl der von Negativ-Einträgen Betroffenen und damit potenziellen Anspruchstellern teuer zu stehen kommen.
Gefällt Ihnen der Beitrag?
Dann unterstützen Sie uns doch mit einer Empfehlung per:
TWITTER FACEBOOK E-MAIL XING
Oder schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Beitrag:
HIER KOMMENTIEREN
© www.intersoft-consulting.de
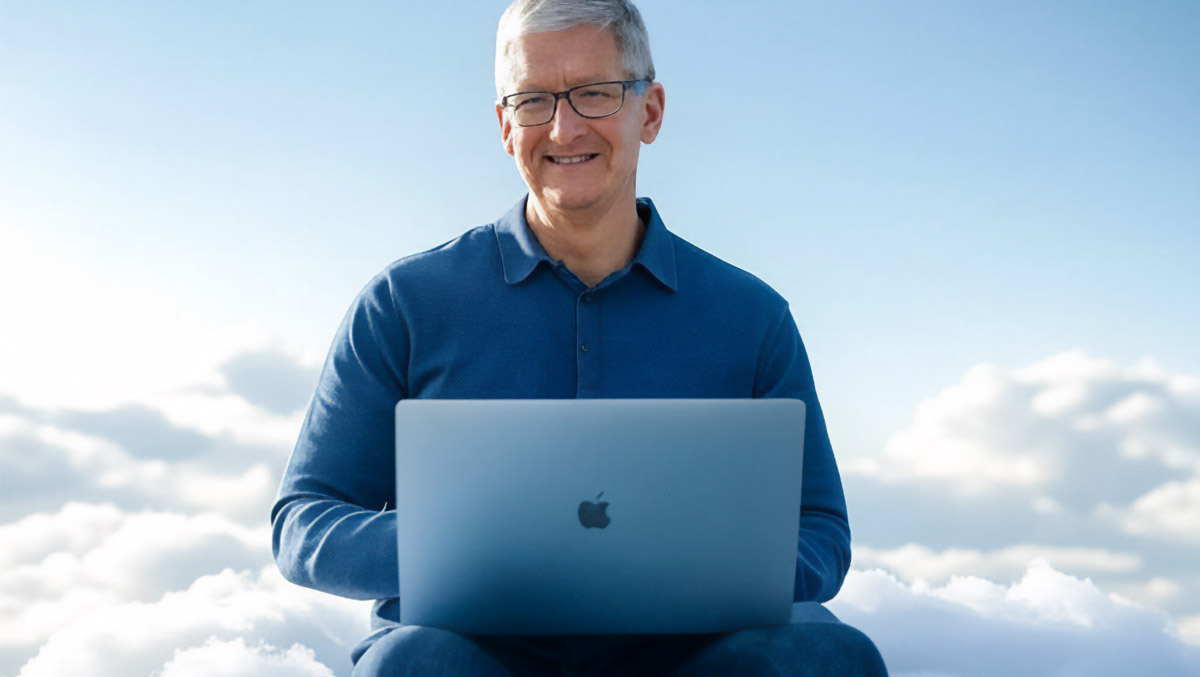


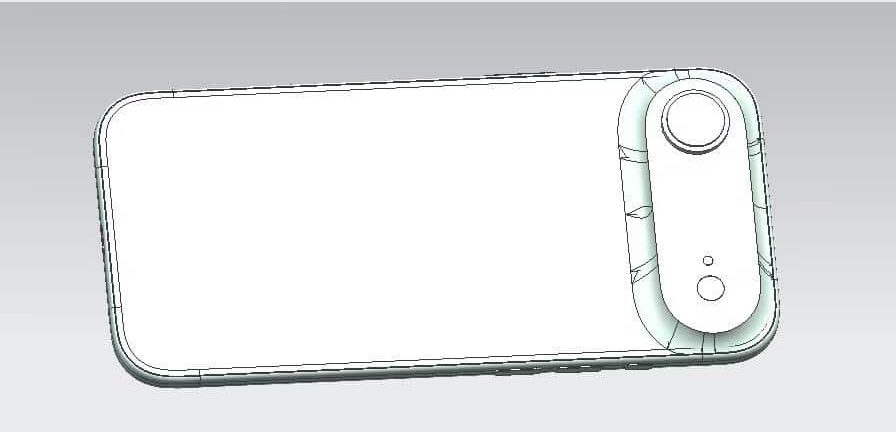



























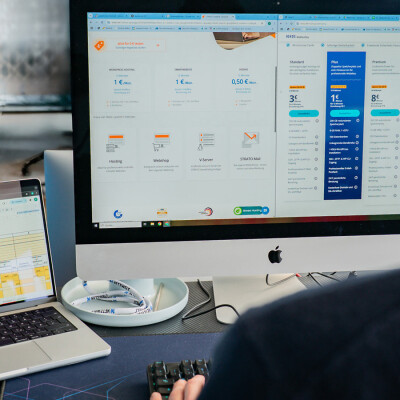


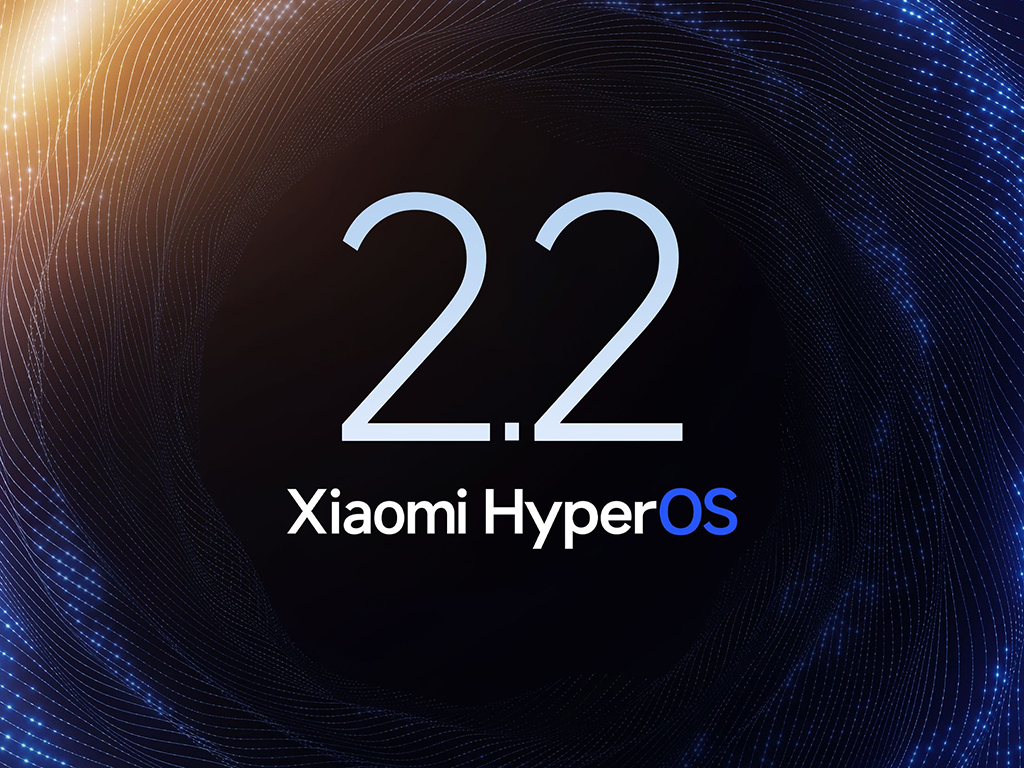
























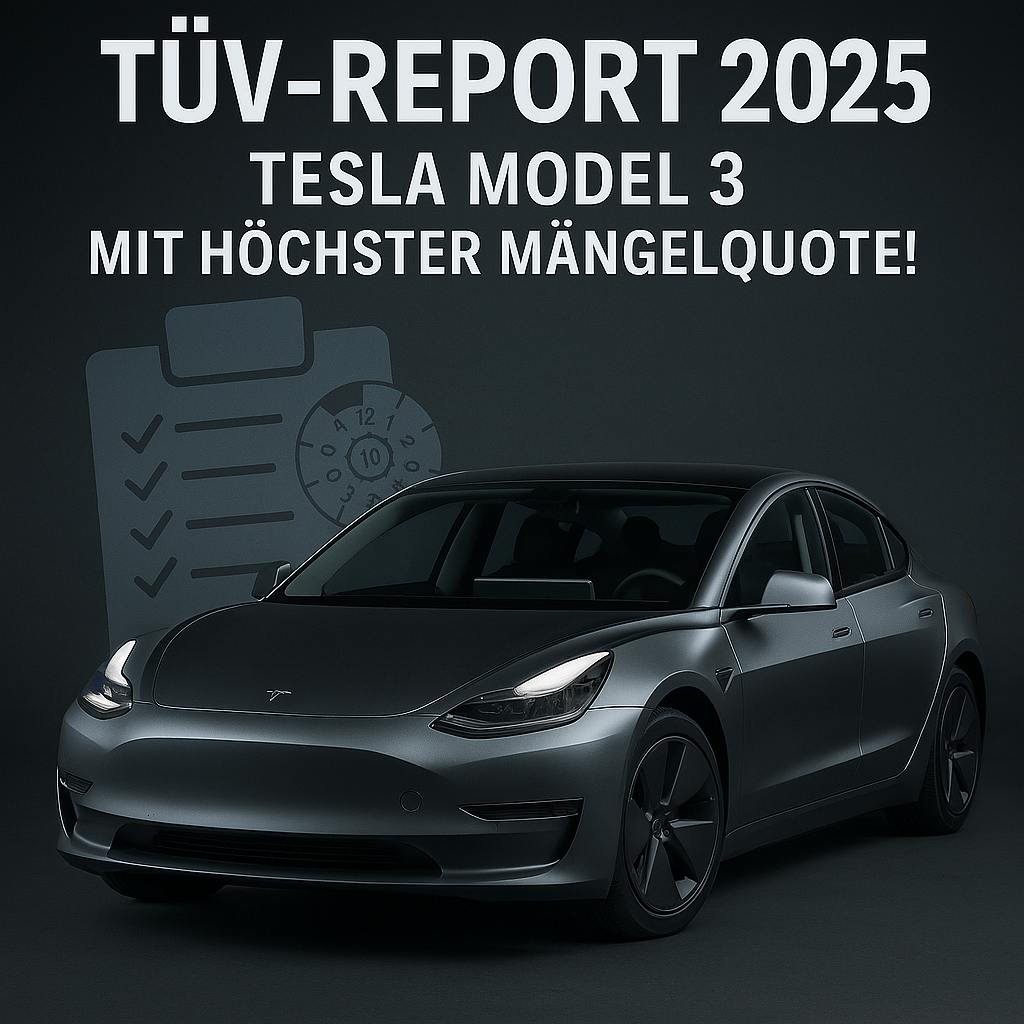
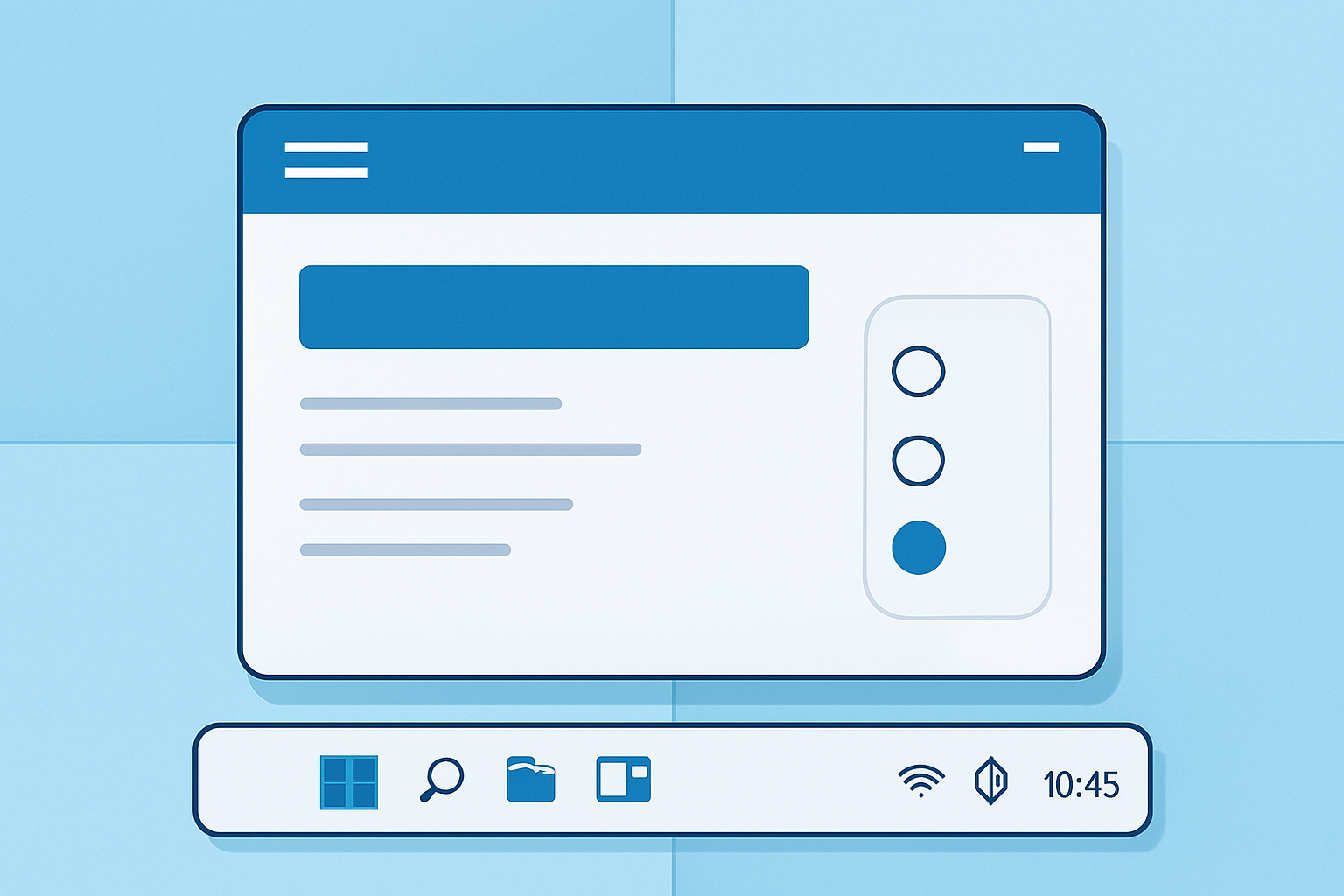











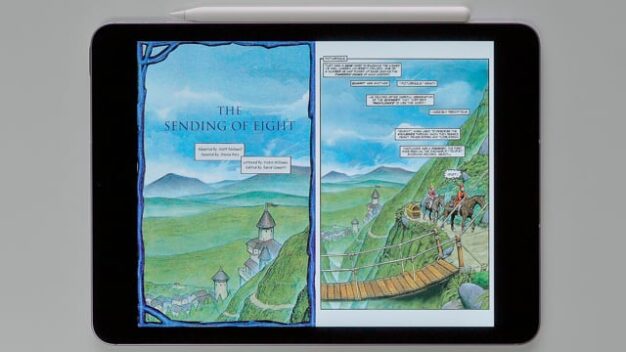
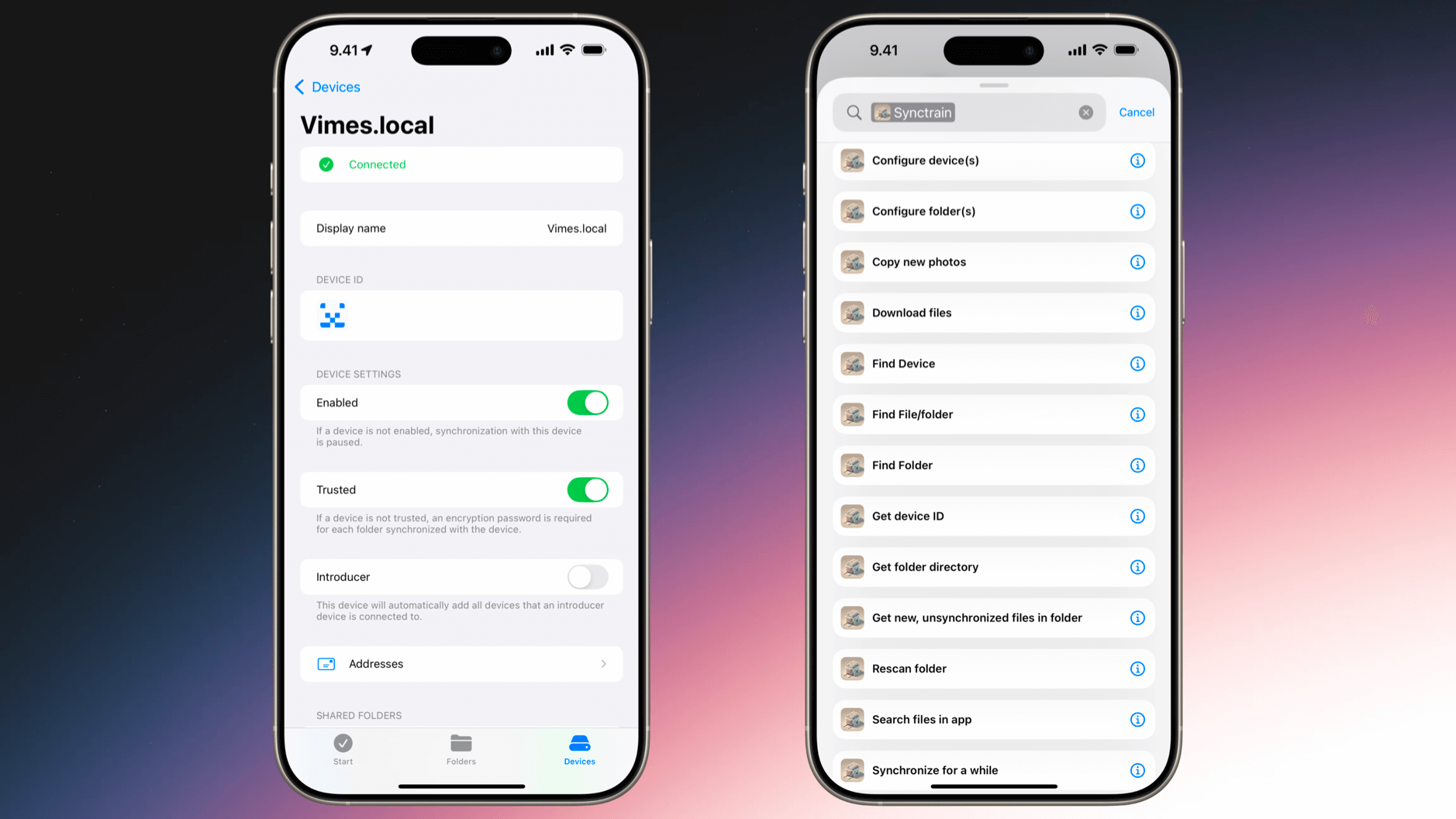
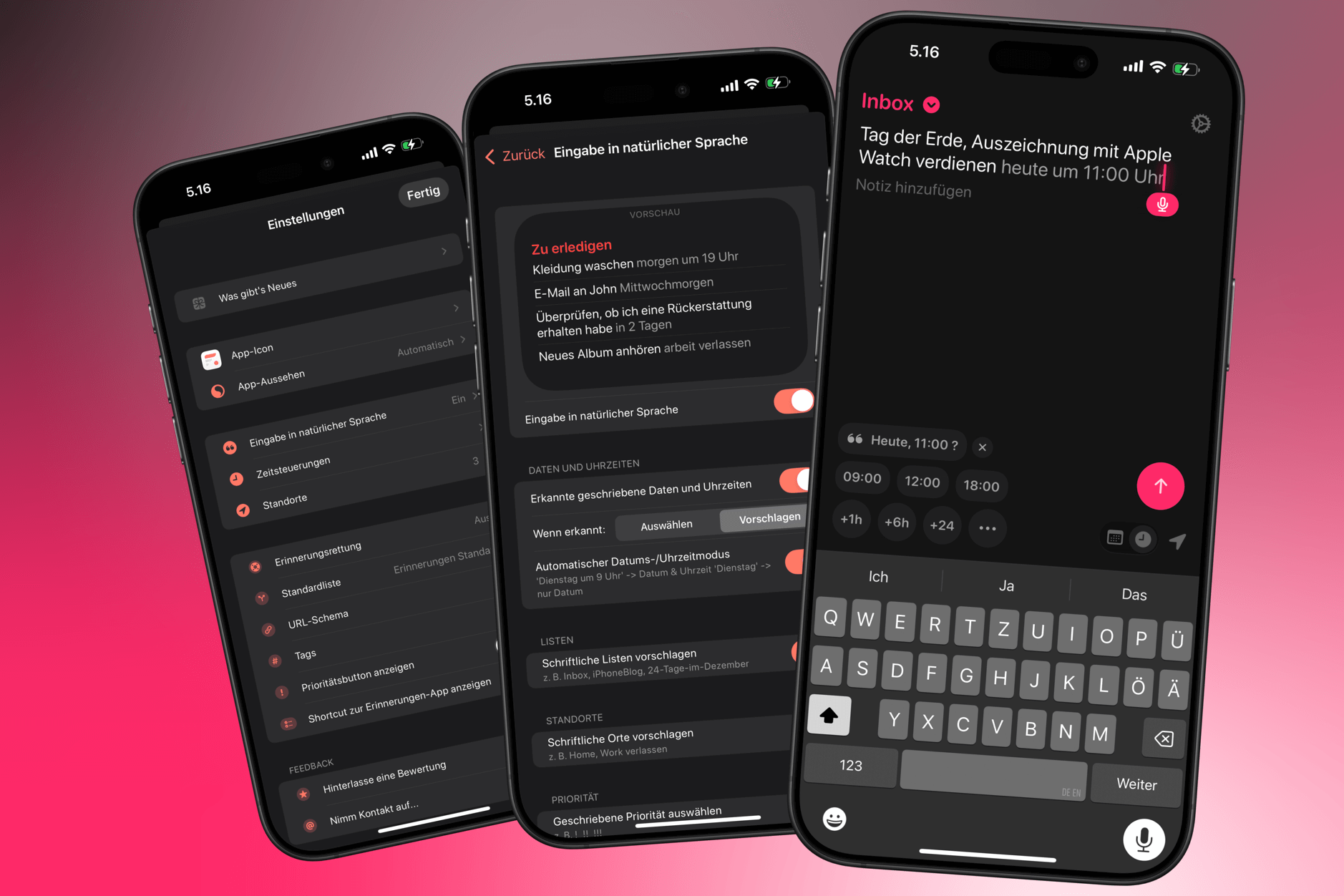







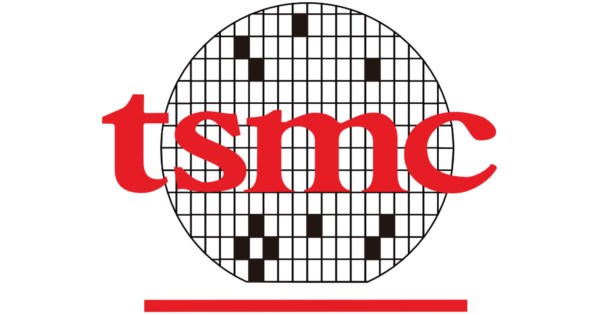
























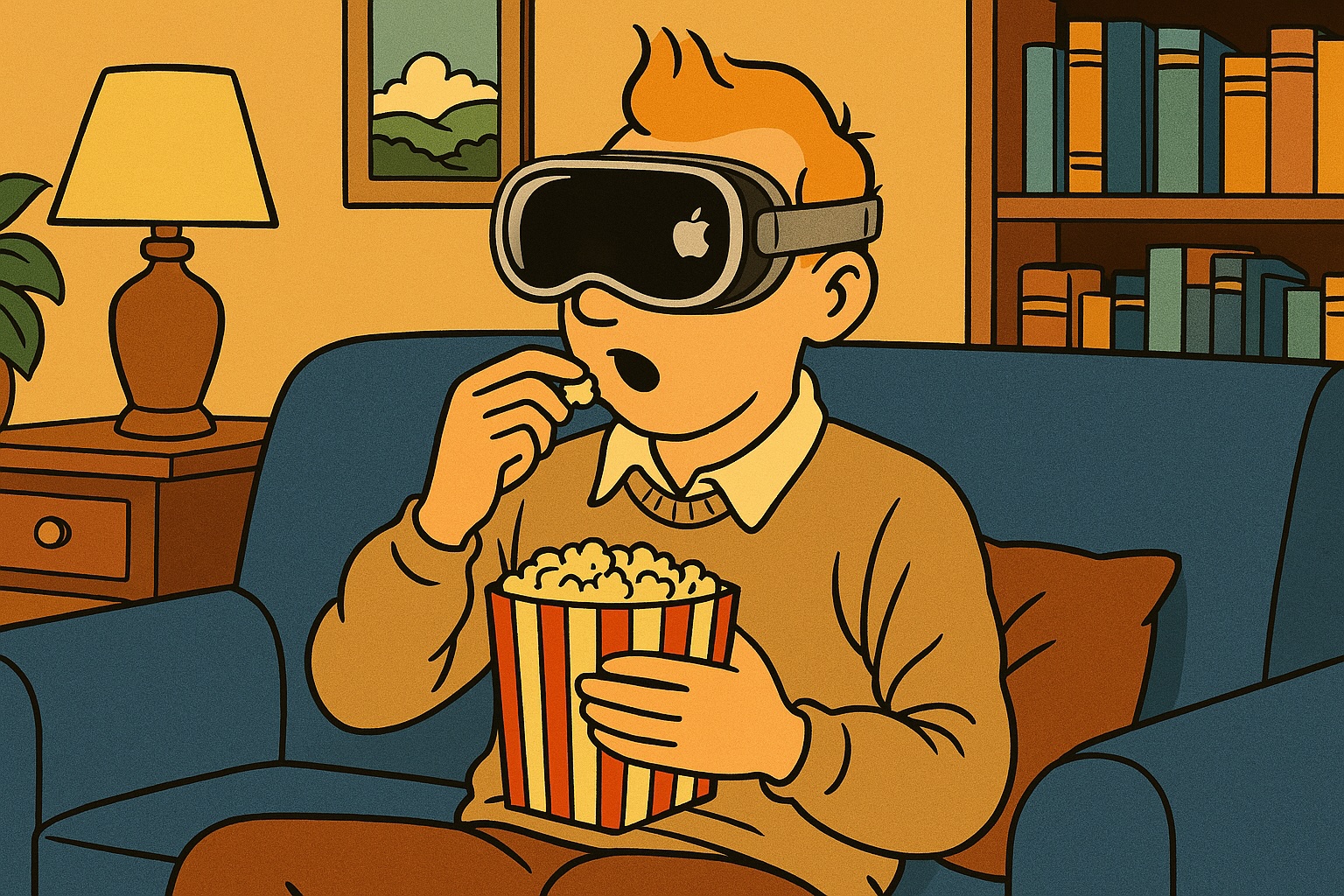



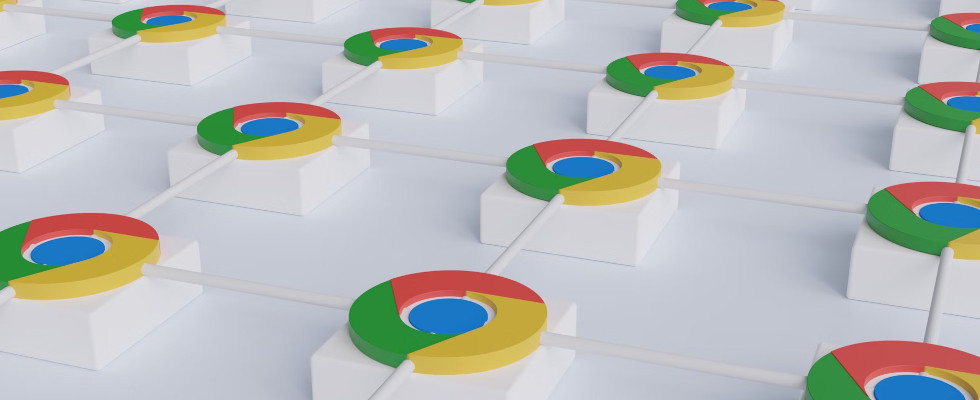
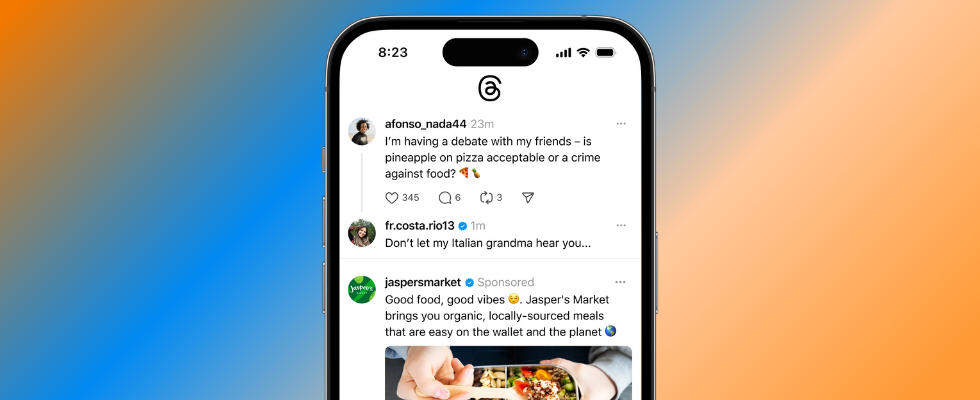




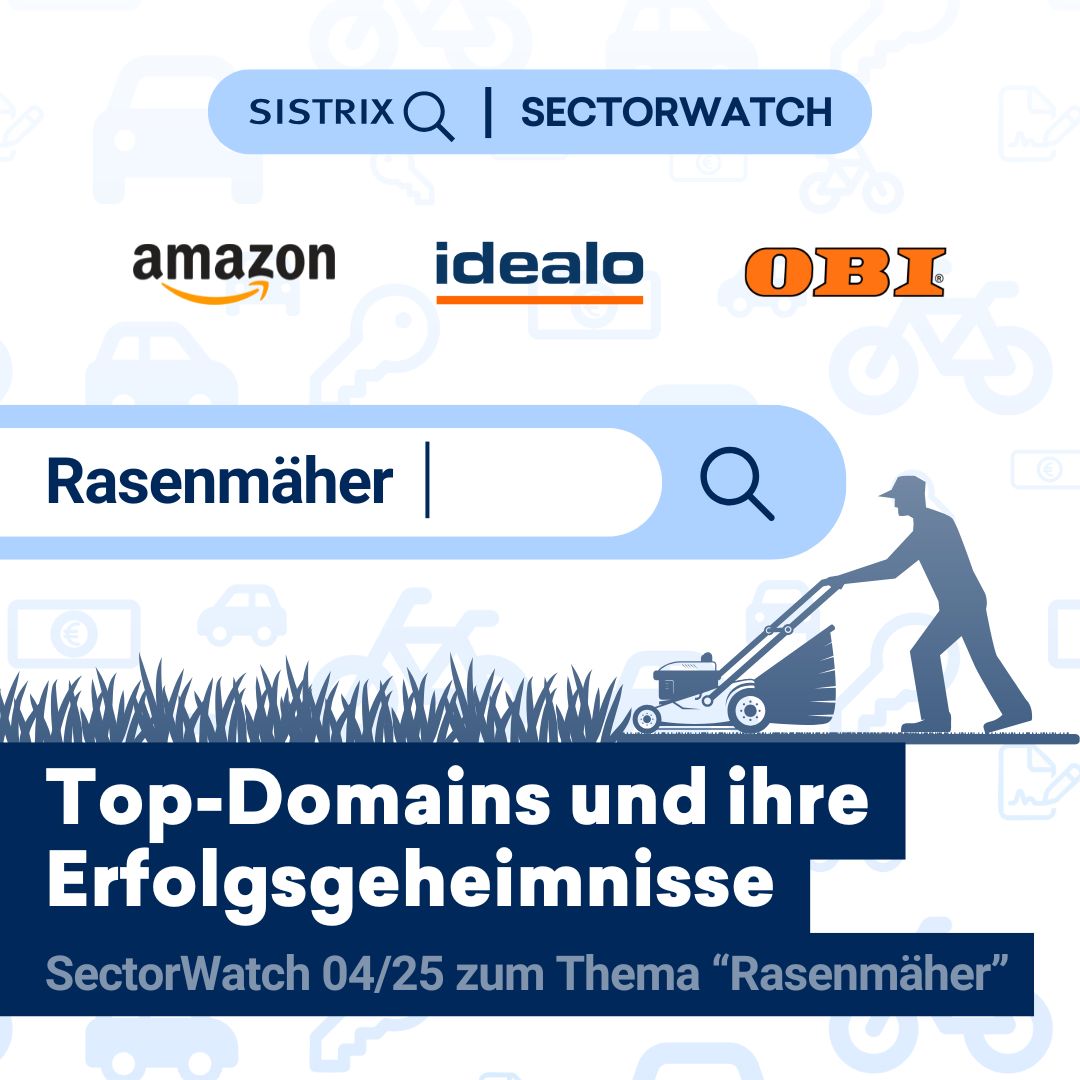
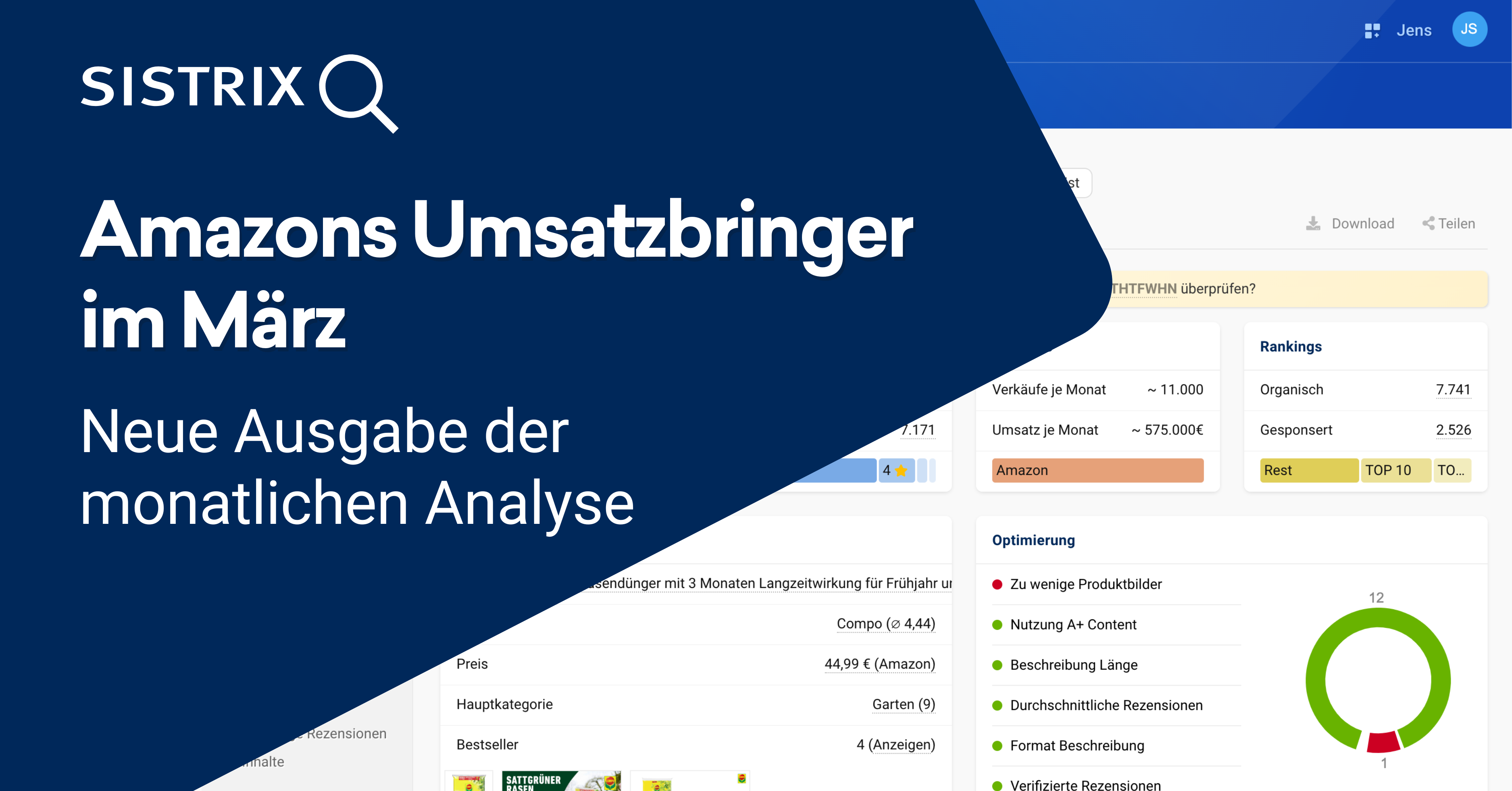

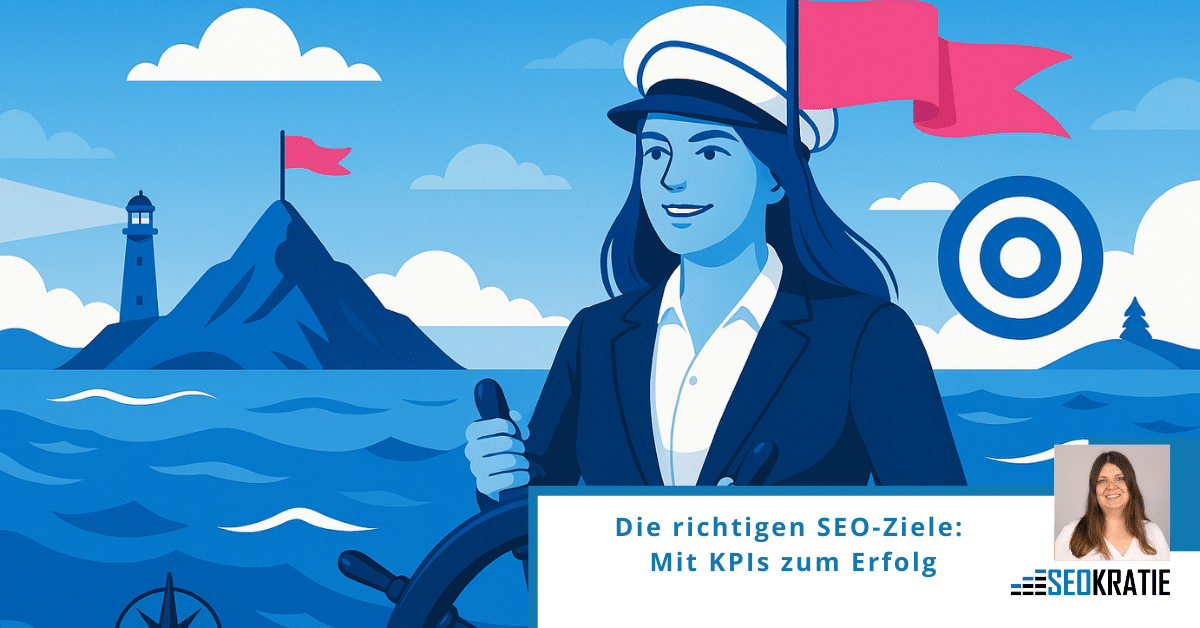
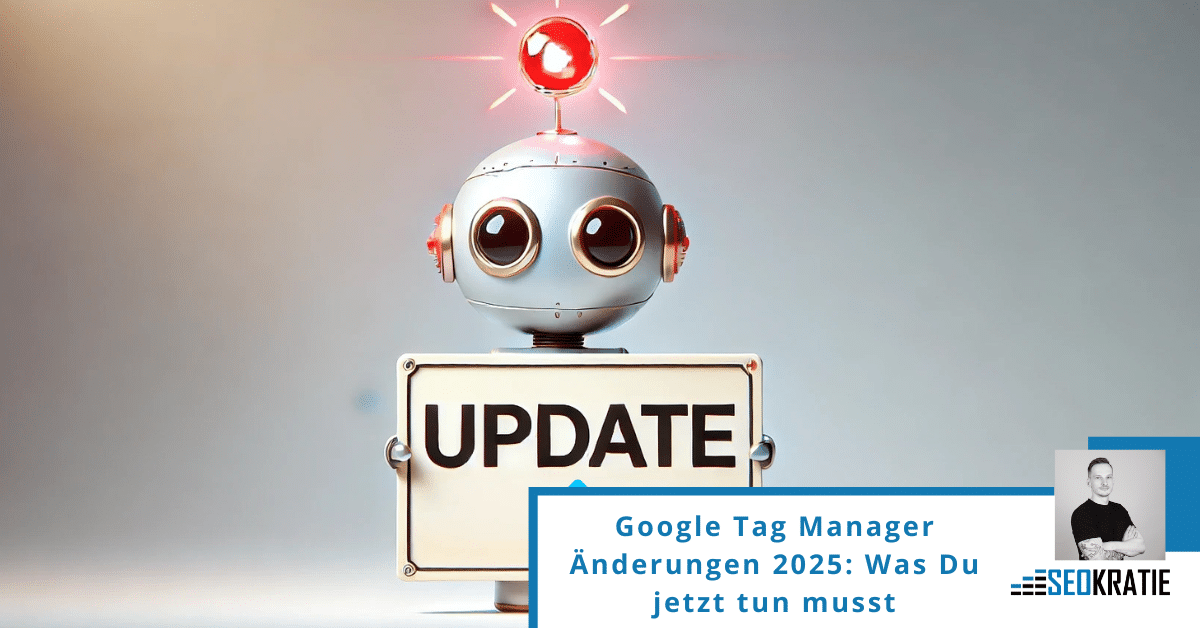


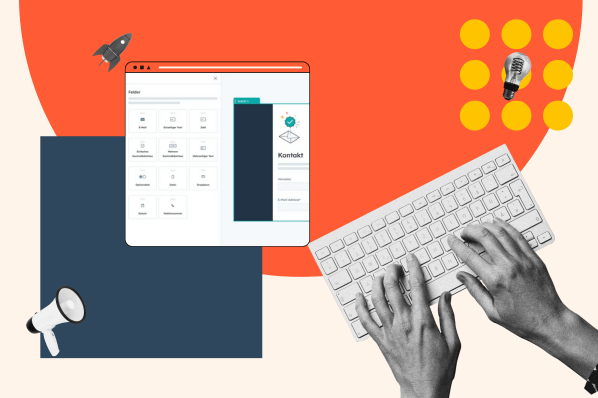
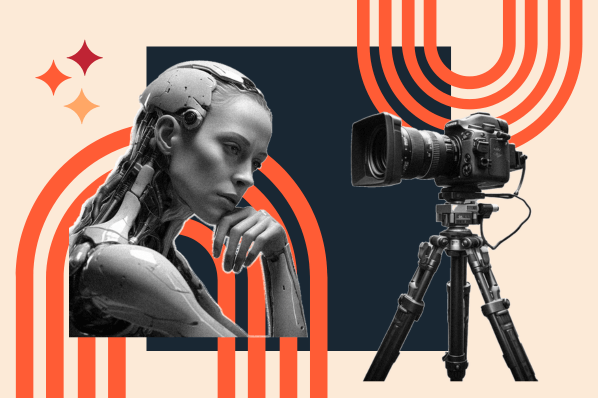

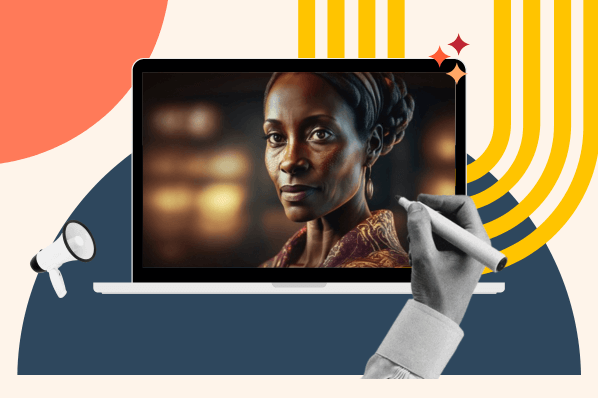


















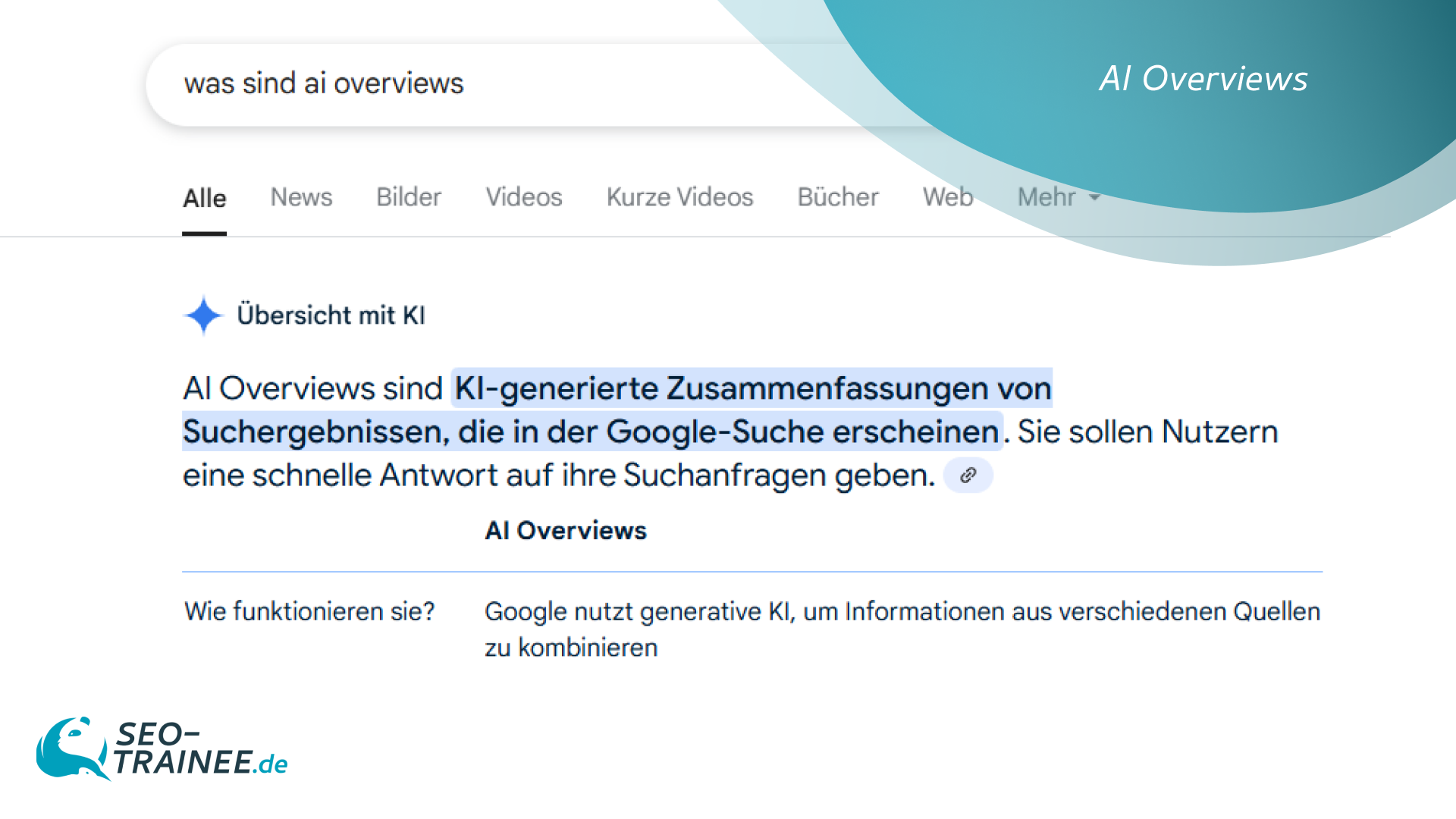

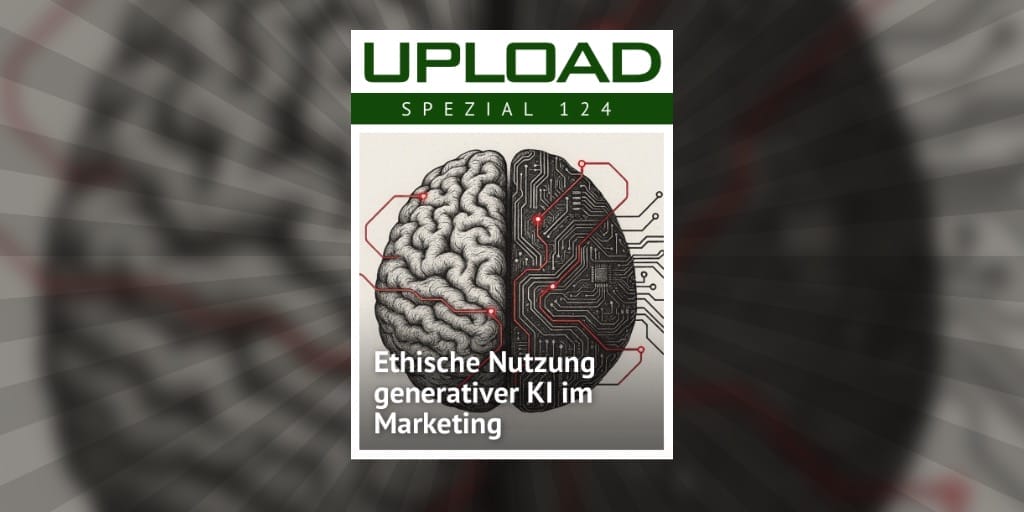











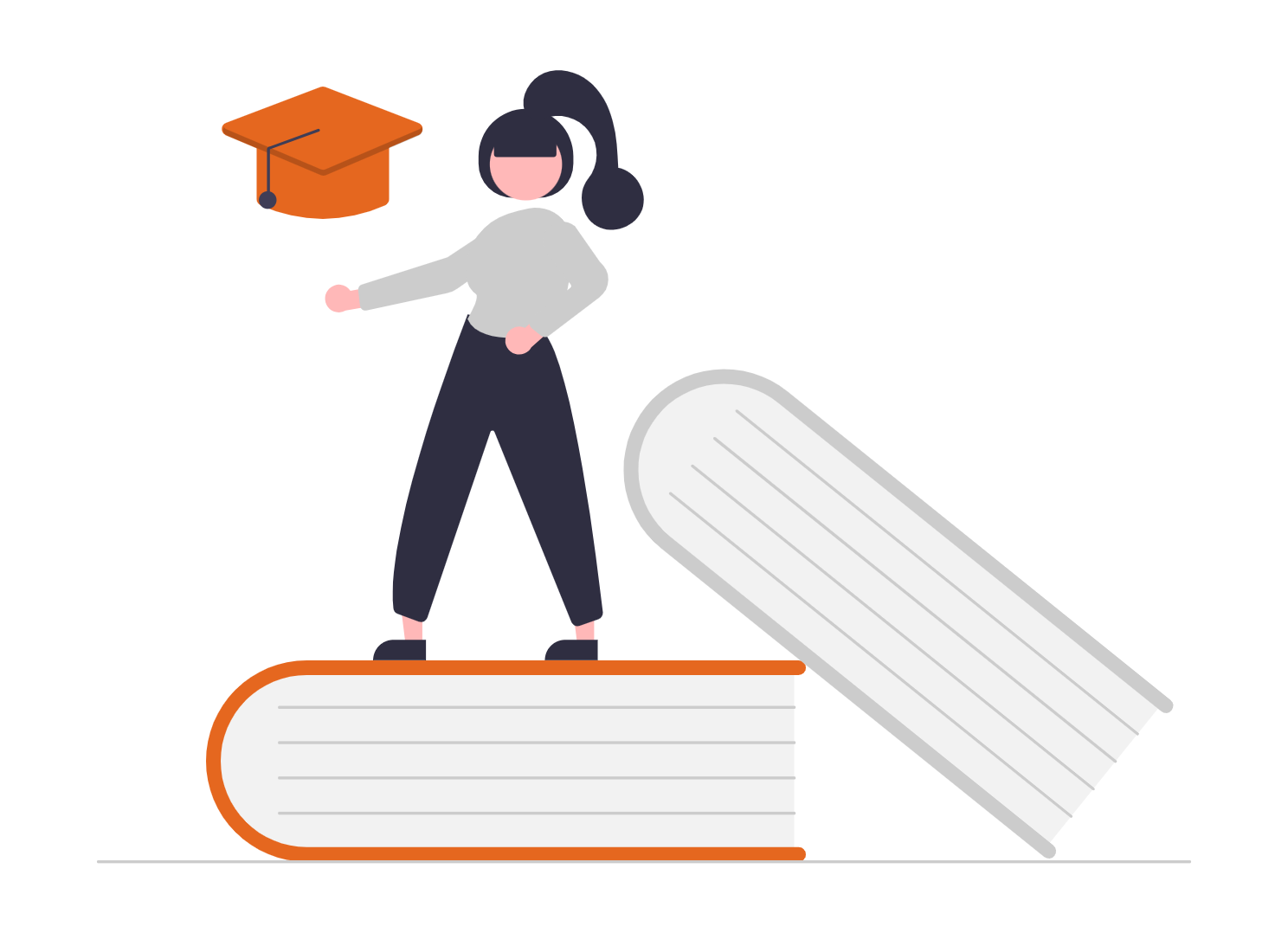













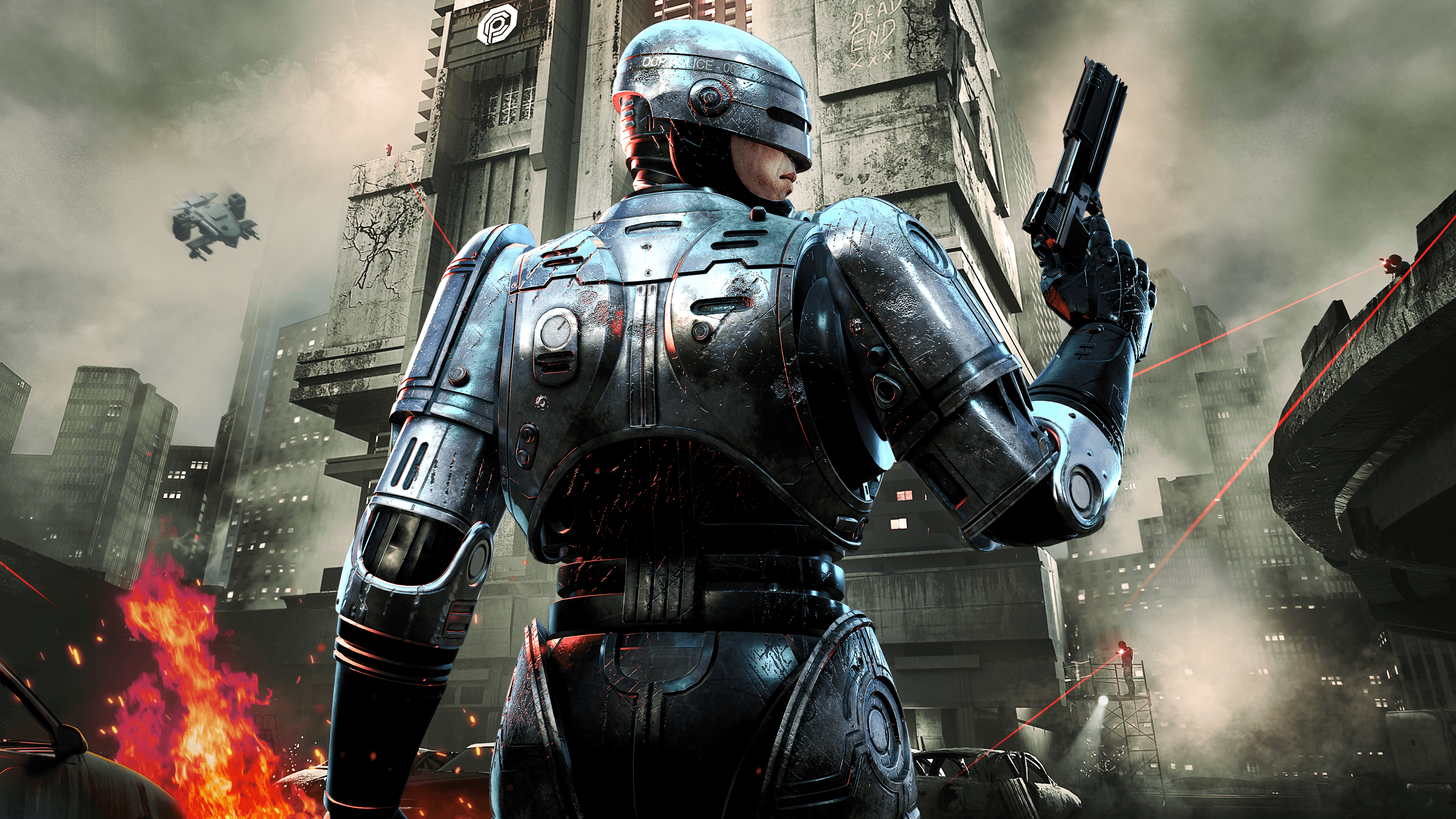



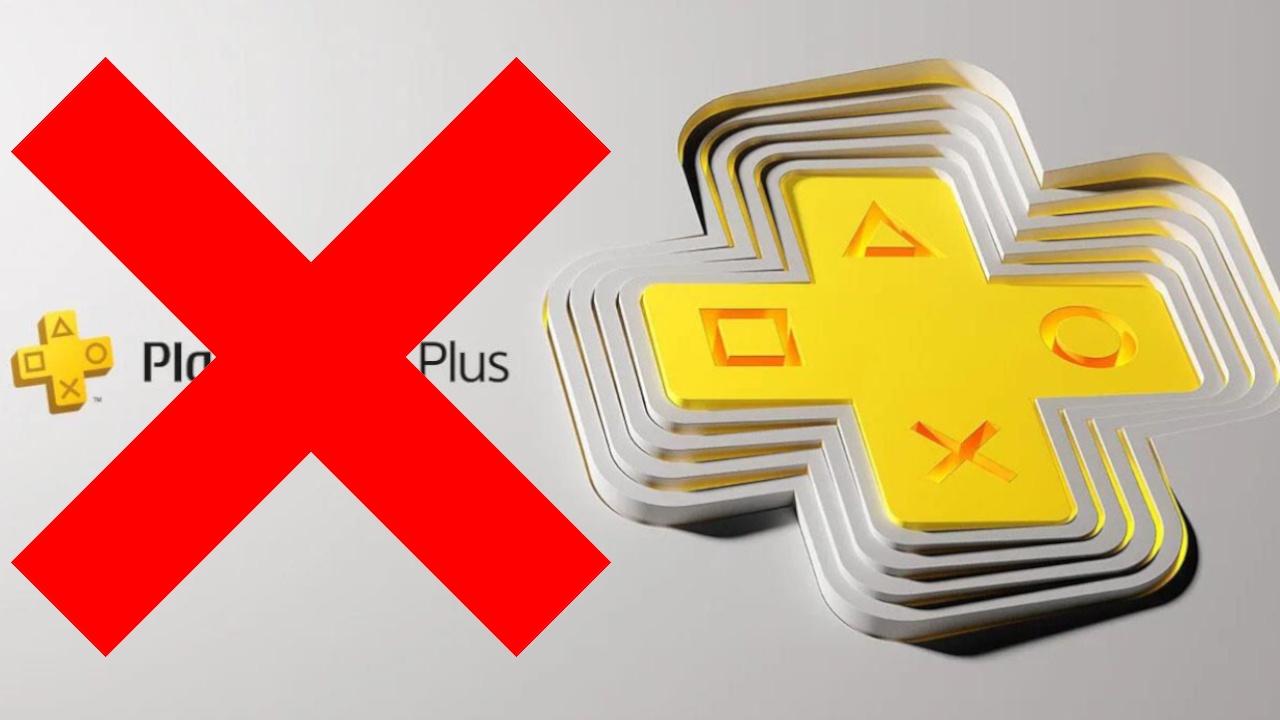














.png?width=1920&height=1920&fit=bounds&quality=70&format=jpg&auto=webp#)



























:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c9/69/c9699a0efca29827ea7699d9a7475533/0124072195v2.jpeg?#)
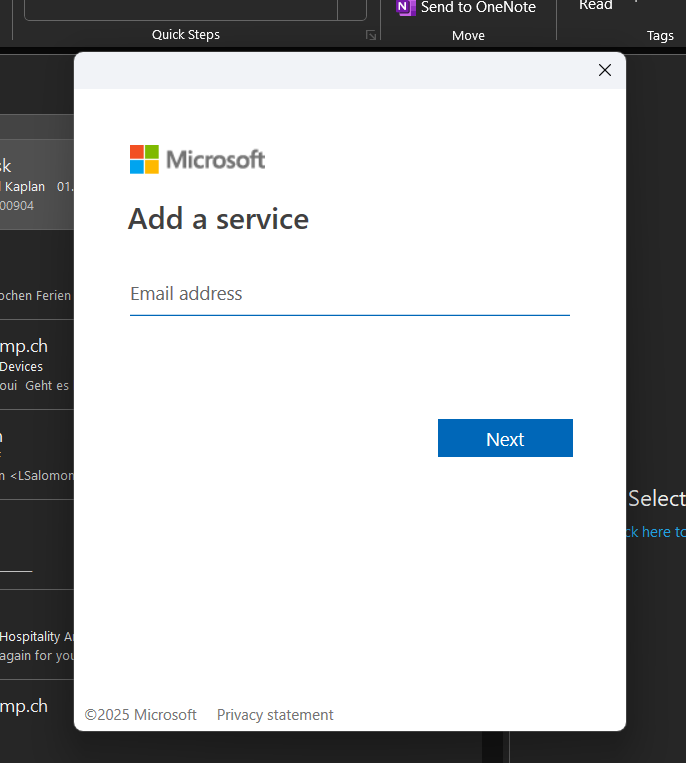


:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a3/79/a379e72440066a4a2521cc171230594e/0123842409v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/83/13/83134f6e0edf16c2aca793e52de06c14/0124351866v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/40/6f402b2eb39659cb328bccff4c8aac0b/0124112799v1.jpeg?#)