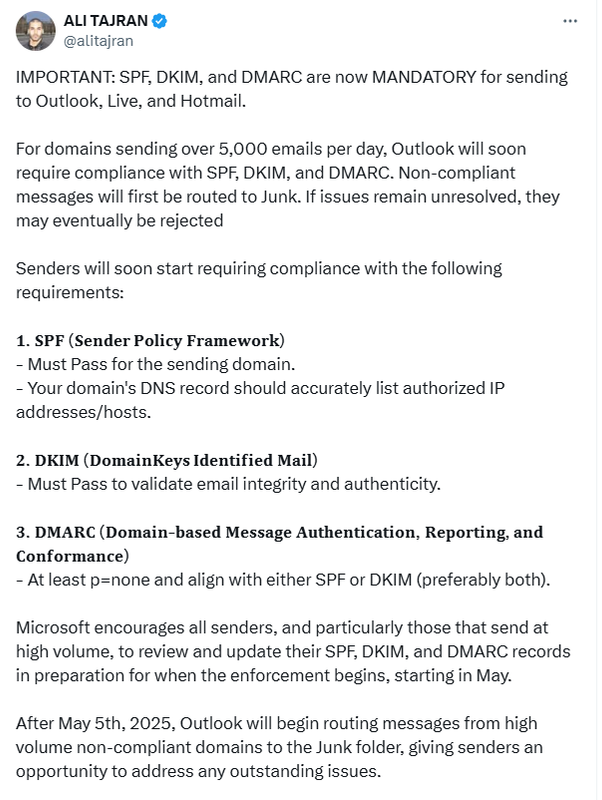10 Prozent auf alles – inklusive Tiernahrung: Seit Anfang April überzieht US-Präsident Donald Trump die Länder der Europäischen Union, eigentlich Verbündete, mit Zöllen. Am 9. April galten für einen knappen Tag zudem deutlich höhere Sätze. Das ist passé, zumindest für 90 Tage. Das aber auch nur vielleicht – wer würde aktuell schon darauf wetten, dass morgen gelten wird, was heute gilt.
Was genau kommen wird, wie die EU reagieren könnte – alles unklar. „Klar ist dagegen: Haben Unternehmen ein transatlantisches Geschäft und ihre Lieferverträge noch nicht oder nicht intensiv auf Regelungen zu Zollgebühren geprüft, sollten sie das spätestens jetzt tun“, sagt Nils Kupka, Rechtsanwalt in Frankfurt am Main und Partner der internationalen Kanzlei Gowling WLG. Wer seine rechtliche Situation genau kenne, könne die eigene Position besser einschätzen, wenn es zu Nachverhandlungen kommt.
Was sollte der erste Schritt sein?
„Listen sie alle Geschäftsbeziehungen in die USA auf mit den entsprechenden Lieferverträgen – und zwar möglichst entlang der gesamten Lieferkette“, empfiehlt Kupka.
Denn Strafzölle und Gegenmaßnahmen beeinflussten nicht nur direkte Geschäfte mit Firmen aus den USA. „Angenommen, ein drittes Unternehmen liefert mir Bauteile für mein Produkt und dieses Unternehmen ist seinerseits von Strafzöllen oder den möglichen Gegenzöllen der EU betroffen. Dann könnte es die Mehrkosten, je nach Vertrag, eventuell an mich weitergeben – oder Nachverhandlungen einfordern“, so der Experte weiter.
Welche Klauseln in Lieferverträgen könnten bei Strafzöllen greifen?
In einem zweiten Schritt sollten Unternehmen dann prüfen, inwieweit die Verträge Klauseln enthalten, die Zollfragen regeln. „Etwa, wenn es darum geht, wer die Zollgebühren trägt oder wann Verträge angepasst oder aufgelöst werden können.“ Hier ein Überblick zu den wichtigsten Klauseln – und dazu, inwieweit diese im aktuellen Handelskonflikt weiterhelfen.
1. Incoterms
Die Abkürzung „Incoterms“ steht für „International Commercial Terms“, umfasst also international anerkannte Handelsklauseln. Incoterms regeln, wer im weltweiten Warenhandel welche Pflichten übernimmt und die Kosten sowie Risiken trägt.
Zwei Beispiele:
Incoterm EXW (Ex Works, „ab Werk“): Diese Handelsklausel stellt die geringsten Anforderungen an Verkäufer. Steht sie im Vertrag, holt der Käufer die Ware zu einem vereinbarten Zeitpunkt an einem vereinbarten Ort ab – und trägt alle anfallenden Kosten, also auch die Zollgebühren.
Incoterm DDP (Delivered duty paid, „Geliefert verzollt“): Diese Handelsklausel weist im Gegenzug dem Verkäufer die meisten Pflichten zu. Steht sie im Vertrag, trägt dieser sämtliche Kosten inklusive Zollgebühren.
„Incoterms sind sehr häufig – und in der Praxis dann auch eindeutig. Wenn etwa ein Autozulieferer Waren in die USA exportiert und den Incoterm DDP im Liefervertrag festgeschrieben hat, muss das Unternehmen die 20 Prozent Strafzoll auf Einfuhren aus der EU komplett selbst tragen“, sagt Kupka.
Und was ist, wenn die Zollkrise – und die damit verbundenen Mehrkosten – die Existenz des Unternehmens gefährden? „Dann bleibt nur, den Vertrag auf mögliche Anpassungs- oder Lösungsrechte durchzusehen. Und, auch wenn solche nicht bestehen sollten, in jedem Fall die Karten auf den Tisch zu legen und mit der Gegenseite in die Verhandlung zu gehen“, so Kupka weiter. Häufig habe ein Unternehmen kein Interesse daran, dass der Handelspartner wirtschaftlich scheitert – etwa, wenn es kaum alternative Lieferanten gibt. „Man ist also nicht zwangsläufig in einer aussichtslosen Verhandlungsposition, wenn im Vertrag steht, dass das eigene Unternehmen die Strafzölle zu tragen hat und keine anderweitigen Regeln zu Vertragsanpassungen bestehen oder greifen.“ Es komme in der Praxis durchaus vor, dass sich beide Seiten dann darauf verständigen, die Mehrkosten aufzuteilen.
2. Die „Force-Majeure“-Klausel
Die „Force-Majeure“-Klausel (französisch für: „höhere Gewalt“) deckt in Verträgen unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse ab, die eine Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen. Doch diese Fälle sind selten. Naturkatastrophen wie Erdbeben zählen etwa dazu, außerdem Kriege und Terrorangriffe.
Hilft eine „Force-Majeure“-Klausel in der aktuellen Zollkrise?
Laut Anwalt Kupka ist es zwar grundsätzlich möglich, über „Force-Majeure“-Klauseln im Fall extremer Mehrbelastungen durch Zollgebühren Verträge aufzulösen – oder ein Recht auf Nachverhandlungen abzuleiten. In der Realität aber sei dies kaum durchsetzbar. Denn dafür müssten folgende Optionen gegeben sein:
Option 1: Plötzlich anfallende oder stark erhöhte Zollgebühren sind als Beispiel für höhere Gewalt in der Klausel aufgelistet und in einem Beispielszenario ausformuliert.
Option 2: Die Strafzölle machen eine Vertragserfüllung unzumutbar oder unmöglich. Kupka: „Das dürfte nur in den wenigsten Fällen zutreffen. Die Zölle machen Lieferungen für Unternehmen vielleicht teurer, behindern sie in aller Regel aber nicht.“ Außerdem dürften die Zollgebühren nicht vorhersehbar gewesen sein. „Das ließe sich im Fall der jetzigen Strafzölle durch US-Präsident Trump kaum belegen. Schließlich hat sich diese Politik schon in seiner ersten Amtszeit angekündigt“, so Anwalt Kupka.
3. Die „Hardship“-Klausel
Die „Hardship“-Klausel (englisch für „Härtefall“) regelt Situationen, in denen es für eine Vertragspartei zwar noch möglich wäre, einen Vertrag zu erfüllen, die Situation das Unternehmen aber wirtschaftlich extrem belasten würde – ohne dass dabei höhere Gewalt im Spiel sein muss. Denkbare Härtefälle umfassen daher auch heftige wirtschaftliche Veränderungen, wie zum Beispiel Preisexplosionen, Rohstoffmängel, unerwartete Regulierungen und Währungsabwertungen.
Hilft eine „Hardship“-Klausel in der aktuellen Zollkrise?
„Das ist absolut denkbar – es kommt allerdings auf die genaue Ausgestaltung des Vertrags insgesamt an“, sagt Anwalt Kupka. Werden in den Verträgen Zölle erwähnt, dann spricht einiges dafür, dass die Parteien das Thema auf dem Schirm hatten – und mögliche Belastungen vielleicht schon einkalkuliert haben.
Ob die Hardship-Klausel dann greife, hänge beispielsweise davon ab, wie hart die Zollgebühren ein Unternehmen träfen. „Bei manchen Unternehmen fallen 20 Prozent Mehrkosten kaum ins Gewicht – dann liegt kein Härtefall vor und die Klausel greift nicht. Wenn die Zollgebühren ein Unternehmen dagegen in seiner Existenz bedrohen, dürfte sie zur Anwendung kommen“, so Kupka.
Dann könnte die betroffene Seite – je nachdem, was für den Härtefall festgeschrieben wurde – den Vertrag auflösen, Preise nachverhandeln oder neue Absprachen verlangen, wie die Zollgebühren auf beide Vertragsparteien verteilt werden.
4. Die „Price-Adjustment“-Klausel
Die „Price-Adjustment“-Klausel (englisch für „Preisanpassung“) ermöglicht es, den Preis eines Produkts oder einer Leistung während der Vertragslaufzeit zu ändern. Die Klausel soll es beiden Seiten erlauben, auf starke wirtschaftliche Veränderungen zu reagieren, die eine Seite unfair treffen könnte. Dazu gehören etwa extreme Schwankungen im Rohstoffpreis oder bei den Energiekosten, außerdem Inflation und Schwankungen im Wechselkurs.
Hilft eine „Price-Adjustment“-Klausel in der aktuellen Zollkrise?
„Gerade bei längerfristigen Lieferverträgen kann eine solche Klausel greifen. Denn darin werden steigende Kosten nicht selten als ein Beispielfall genannt, der eine Preisanpassung rechtfertigt“, sagt Kupka. Allerdings: Wie der Name nahelegt, erlaubt die Klausel nur, den Preis nachzuverhandeln – nicht, den Vertrag aufzulösen.
Ein Vorteil: Nicht selten lässt sich laut Kupka trotz einer auf den ersten Blick nur schwach ausgestalteten Preisanpassungsklausel eine gute Verhandlungsposition aufbauen. Im Einzelfall ist der Wortlaut nämlich so, dass man sich nicht nur Verhandlungen schuldet, sondern auch die Einigung auf ein interessengerechtes Ergebnis. „Greift die Klausel, die Gegenseite bewegt sich aber gar nicht oder macht mir ein Angebot, das für mich im Grunde keinen Vorteil bietet, dann muss ich das nicht annehmen.“ In dem Fall habe das belastete Unternehmen in der Regel auch ein Zurückbehaltungsrecht, kann seine Lieferung also pausieren – bis sich etwas in seinem Sinne tut.
5. Die „Change in Law“-Klausel
Die „Change-in-Law“-Klausel (englisch für „Änderung der Gesetzlage“) regelt was passiert, wenn sich innerhalb der Vertragslaufzeit gesetzliche Vorgaben so ändern, dass es für eine Seite deutlich schwieriger, teurer oder unmöglich wird, einen Vertrag zu erfüllen. Dazu gehören etwa Gesetze, die höhere Steuern bedingen, striktere Umweltvorschriften, Einfuhrbeschränkungen – oder eben Strafzölle.
Hilft mir eine „Change in law“-Klausel in der aktuellen Zollkrise?
„Im Ausland spielen diese Klauseln eine größere Rolle. In der Beratung deutscher Unternehmen sieht man den Anwendungsbereich bereits durch andere Regelungen abgedeckt“, sagt Anwalt Kupka. Insbesondere die Regelungen zu Force Majeure und Hardship werden thematisch auch bei Gesetzesänderungen herangezogen. Ob sie helfen, ist damit allerdings noch nicht gesagt.
6. „Indexation“-Klausel und „Cost-plus“-Klausel
Steht in einem Vertrag eine Indexierungsklausel, wird der Preis einer Ware oder Dienstleistung an einen Index gekoppelt – etwa den Inflations-, Rohstoffpreis-, Lohn- oder Wechselkursindex. Dies soll faire Preise garantieren für den Fall, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb der Vertragslaufzeit ändern.
Einen ähnlichen Zweck verfolgt die Kosten-Plus-Klausel, auch Selbstkosten-Klausel genannt: Hier zahlt der Käufer neben einem Basispreis, mit dem die Kosten gedeckt werden, einen Aufschlag, etwa eine pauschale Gewinnmarge, einen Risikozuschlag oder einen prozentualen Aufschlag auf bestimmte Kosten.
Helfen mir die „Indexation“-Klausel und die „Cost-Plus“-Klausel in der aktuellen Zollkrise?
„In aller Regel: nein“, sagt Anwalt Kupka. Auch diese Klauseln spielten bei gewöhnlichen Warenlieferungsverträgen in der Praxis kaum eine Rolle – man finde sie gewöhnlich bei Mietverträgen oder bei sehr großen Projekten. „Gerade Cost-Plus Klauseln haben ihren Ursprung in Fällen mit einem zumeist hohen, nur schwer überblickbaren Kostenaufwand. Etwa, wenn ein Unternehmen einen großen Windpark aufbauen will. Nicht aber bei einem einfachen Liefervertrag“, so der Experte weiter.
Was passiert, wenn im Vertrag Regelungen zu möglichen Zollgebühren fehlen?
„In dem Fall trägt für gewöhnlich jene Seite alle Zollgebühren, die das Produkt oder die Dienstleistung kauft“, sagt Kupka.
Was, wenn ein Unternehmen Zollgebühren umlegt, die es laut Vertrag selbst zahlen müsste?
Unternehmen mit großer Marktmacht könnten versuchen, etwa die von der US-Regierung erhobenen Strafzölle auf die liefernden Unternehmen abzuwälzen. Beispielsweise, um die höheren Kosten nicht an die Verbraucher weitergeben zu müssen und so im Wettbewerb einen Preisvorteil zu haben.
„Niemand kann einem Unternehmen verbieten, so etwas zu versuchen“, sagt Anwalt Kupka. Dann gelte es, zu prüfen, wie stark die eigene Verhandlungsposition ist – inwieweit es also beispielsweise andere Abnehmer für das eigene Angebot gibt, auf die man ausweichen könnte, sollte das belieferte Unternehmen die Zölle nicht übernehmen wie vertraglich vereinbart. Und dann zu verhandeln.
Was bleibt Unternehmen, die Zollgebühren zahlen müssten, sie aber nicht tragen können?
„In dem Fall steht man relativ schutzlos da. Aber natürlich bleibt es Unternehmen in jeder Lage unbenommen, mit dem Vertragspartner zu verhandeln“, erklärt Anwalt Kupka. Viele Unternehmen versuchten auch, sich auf deutsches Recht zu berufen: So sieht Paragraf 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches bei einer „Störung der Geschäftsgrundlage“ die Möglichkeit vor, einen Vertrag anzupassen oder sogar von dem Vertrag zurückzutreten. „Bei der aktuellen Zollproblematik hat das jedoch kaum Aussicht auf Erfolg“, sagt Anwalt Kupka.
Denn diesen Paragrafen hätten schon während der Coronapandemie viele Betriebe anzuwenden versucht – meist vergeblich. „Die Rechtsprechung von damals lässt sich gut auf die jetzige Situation übertragen. Um den Paragrafen für sich nutzen zu können, müssen ähnliche Bedingungen erfüllt sein wie bei einer ‚Force-Majeure‘-Klausel. Man müsste also etwa belegen, dass Strafzölle unvorhersehbar waren und eine Vertragserfüllung unmöglich machen. Und das wird, wie schon gesagt, kaum klappen“, so der Anwalt.
Unternehmen bleibe dann wieder nur, mit der Gegenseite offen zu verhandeln. Und darzulegen, inwieweit Straf- oder Gegenzölle den Betrieb gefährdeten. „Wenn ein Unternehmen sagt: ‚Die Strafzölle werden mich ruinieren, können wir eine Lösung finden?‘, wird die Gegenseite sehr wahrscheinlich neu verhandeln – jedenfalls dann, wenn sie wirklich einen Nachteil davon hätte, dass das zollpflichtige Unternehmen Schaden nimmt“, so Kupka.
Was sollte ich bei neuen Verträgen beachten?
Lange mussten sich viele Unternehmen über Zölle kaum Gedanken machen – und ebensowenig über entsprechende Klauseln. „Das ist absolut vorbei“, sagt Anwalt Kupka. „Die Situation ist inzwischen extrem dynamisch, Zollgebühren als Druckmittel sind momentan parkettfähig, momentan kommt jeden Tag eine neue Zollmeldung. Daher sollten kein Unternehmer und keine Unternehmerin darauf hoffen, dass sich die Situation schon irgendwie einpendeln wird.“
Kupka rät, bei neuen Lieferverträgen möglichst konkret über die oben genannten Klauseln zu regeln, wie mit Zollgebühren umgegangen werden soll. „Am besten ist, im Vertrag verschiedene Beispielszenarien darzulegen – denn aktuell weiß ja niemand, in welche Richtung sich die Zollpolitik in Zukunft entwickeln wird“, so der Anwalt.
Wichtig sei dabei, sich vorab die eigene Verhandlungsposition klarzumachen und dann Regelungen in den Vertragsentwurf zu setzen, die günstig für das eigene Unternehmen seien – aber zumindest im Einklang steht mit der eigenen Verhandlungsmacht. Kupka: „Sonst wird die Gegenseite den Vertrag kaum annehmen, und es gibt direkt zu Beginn einen Konflikt.“
The post Zollkrise: Was du rechtlich jetzt wissen und tun solltest appeared first on impulse.


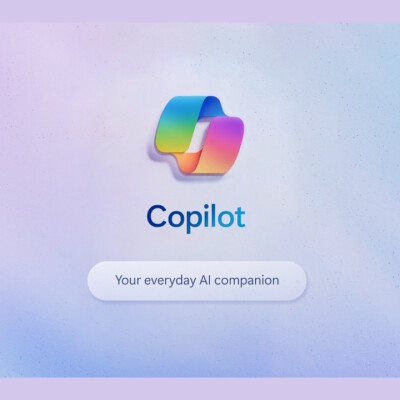


,regionOfInterest=(258,202)&hash=63be2606b76969b828d75e76c2f70f2cadded7ea6fbac27fb573cacf796280bf#)


























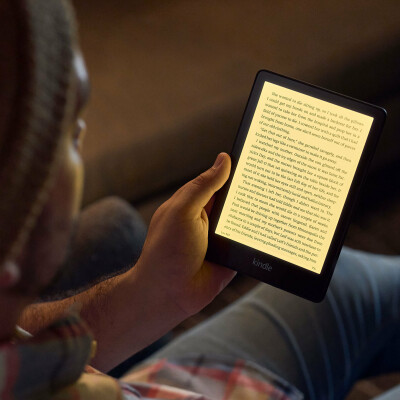
























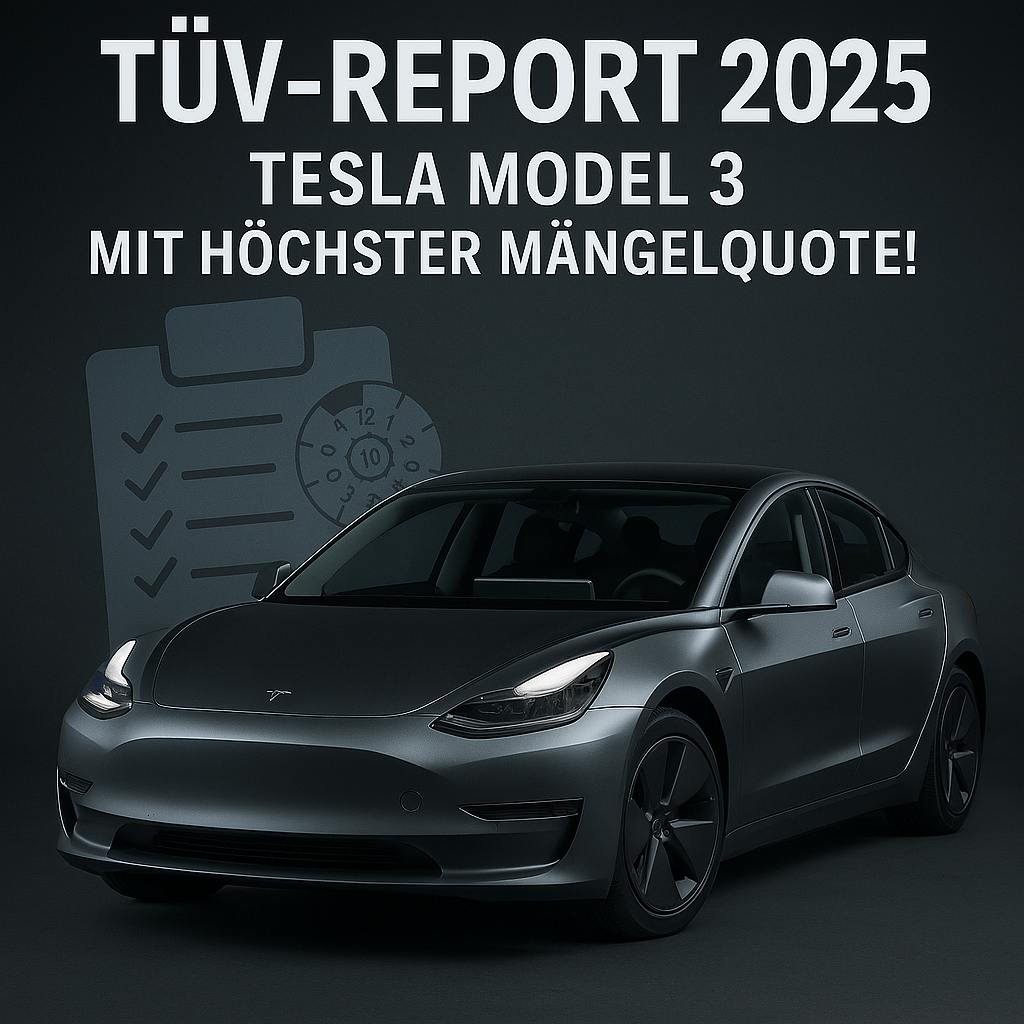
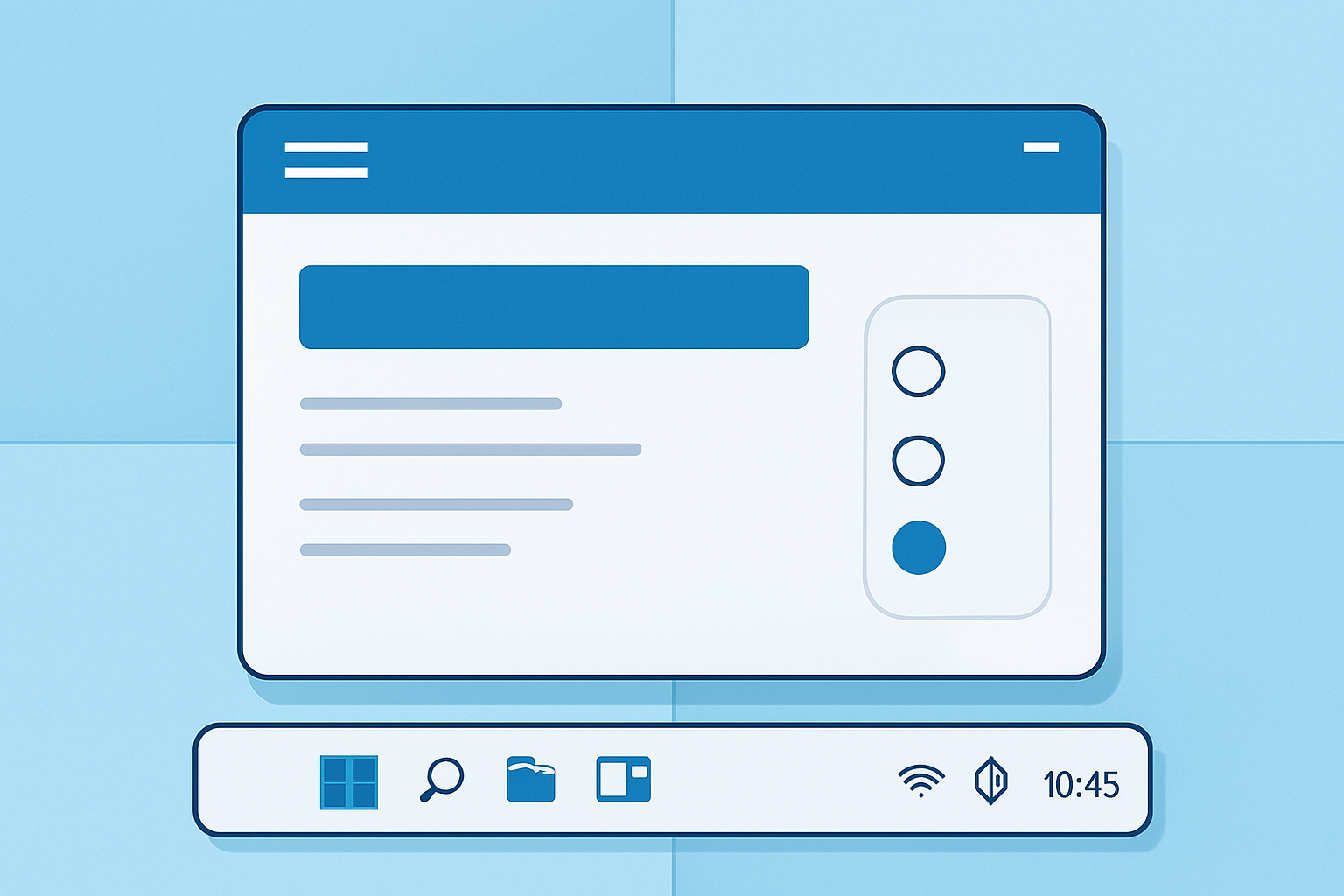

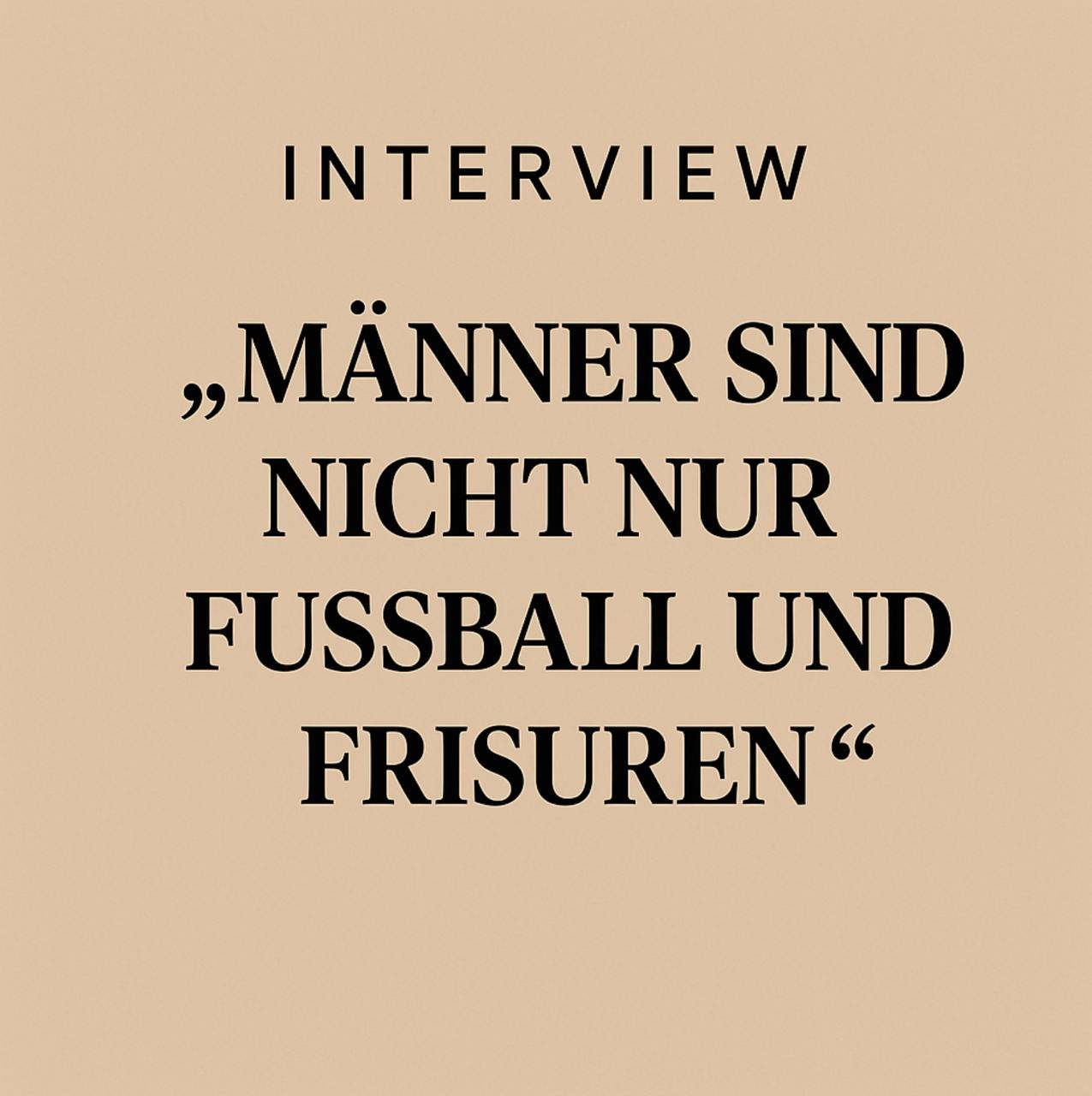












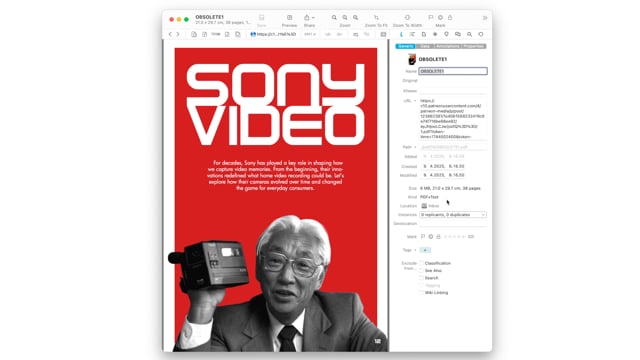

















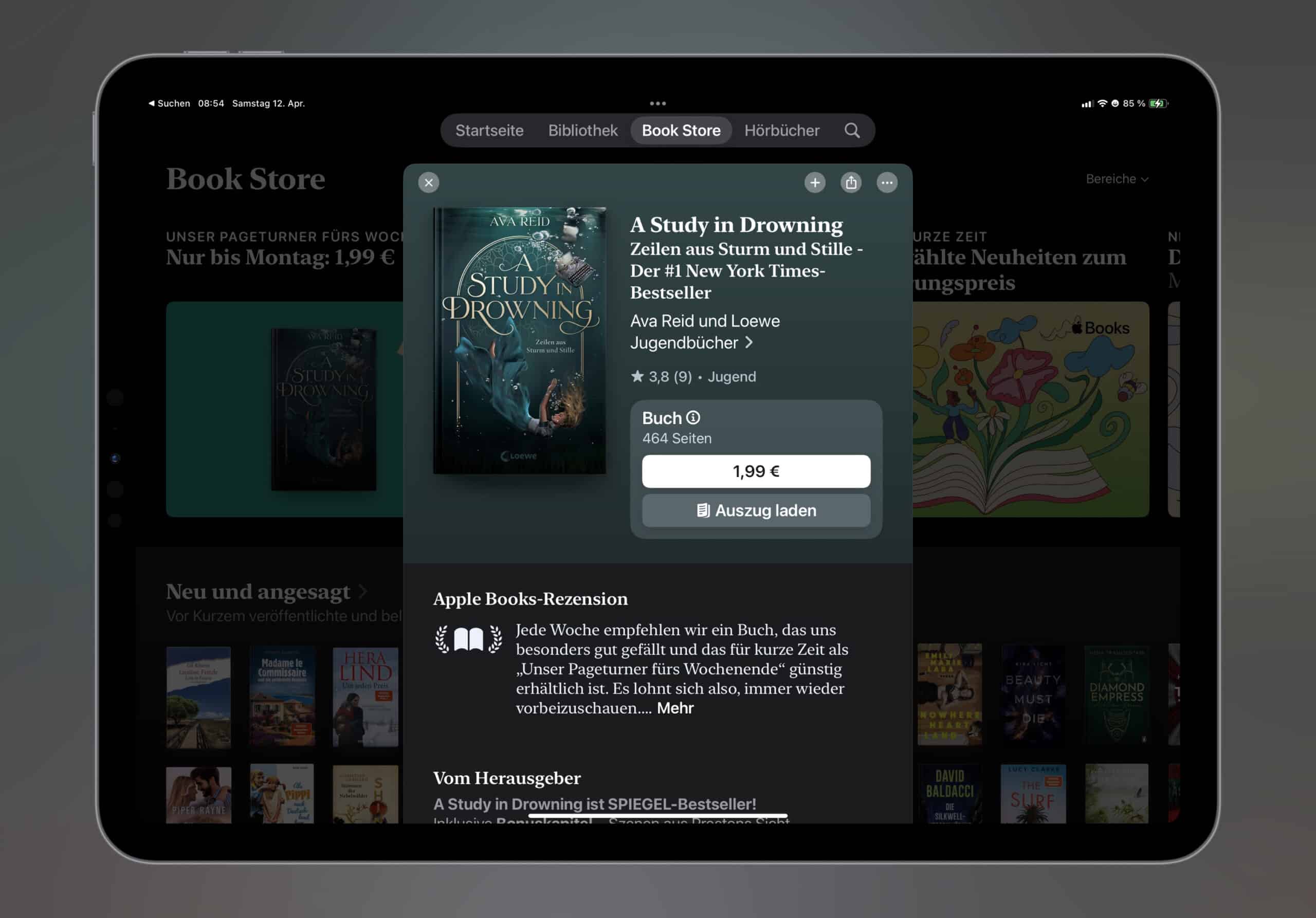
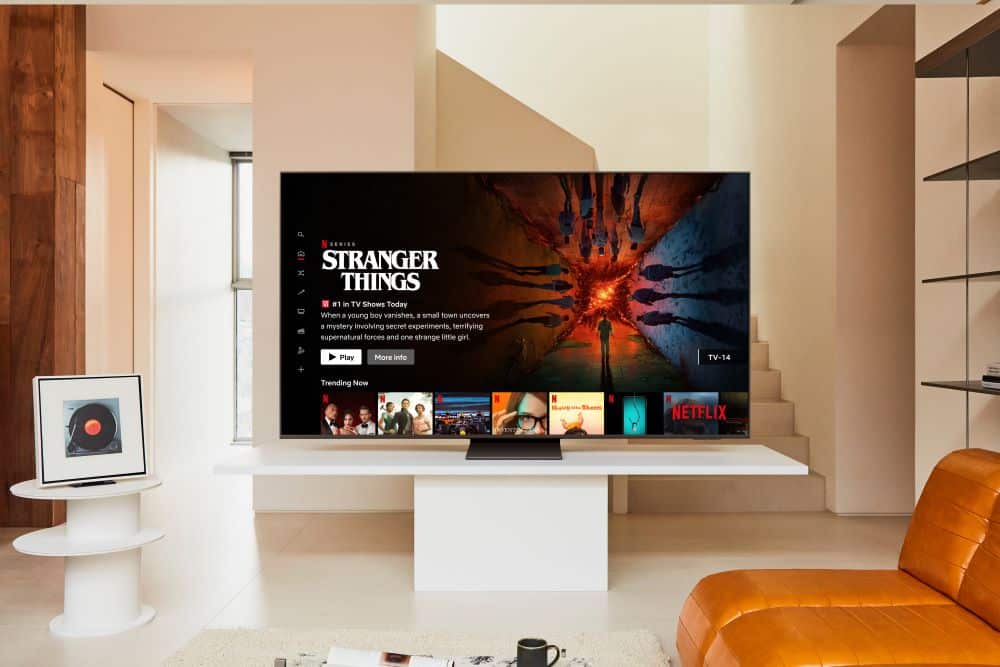




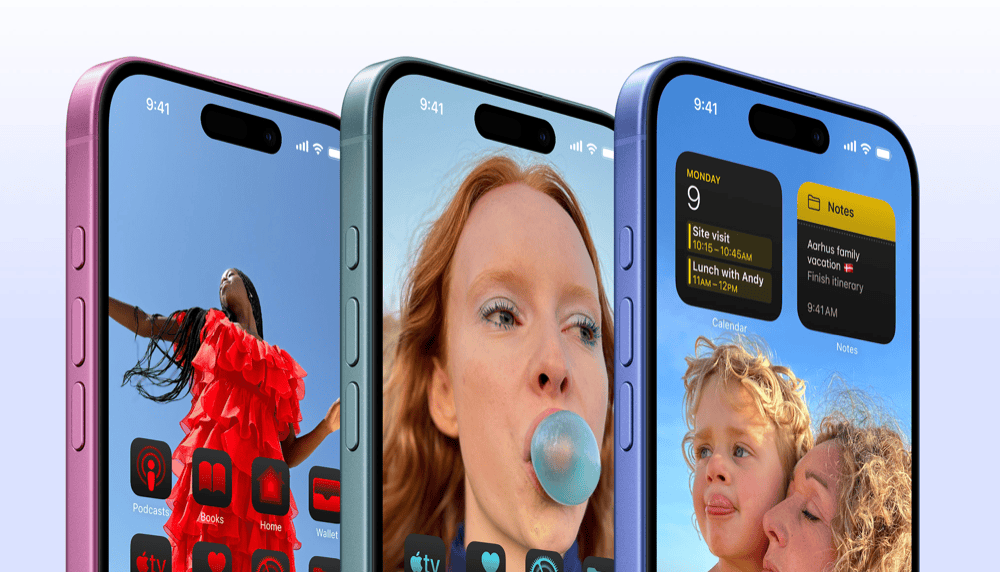









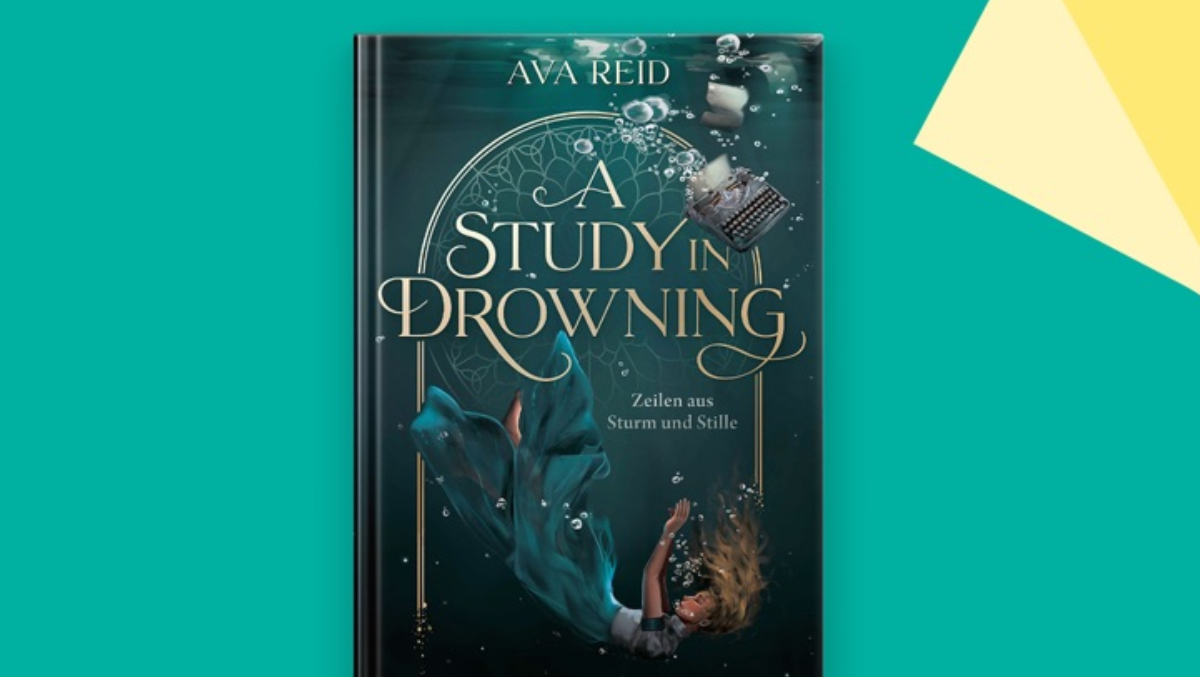

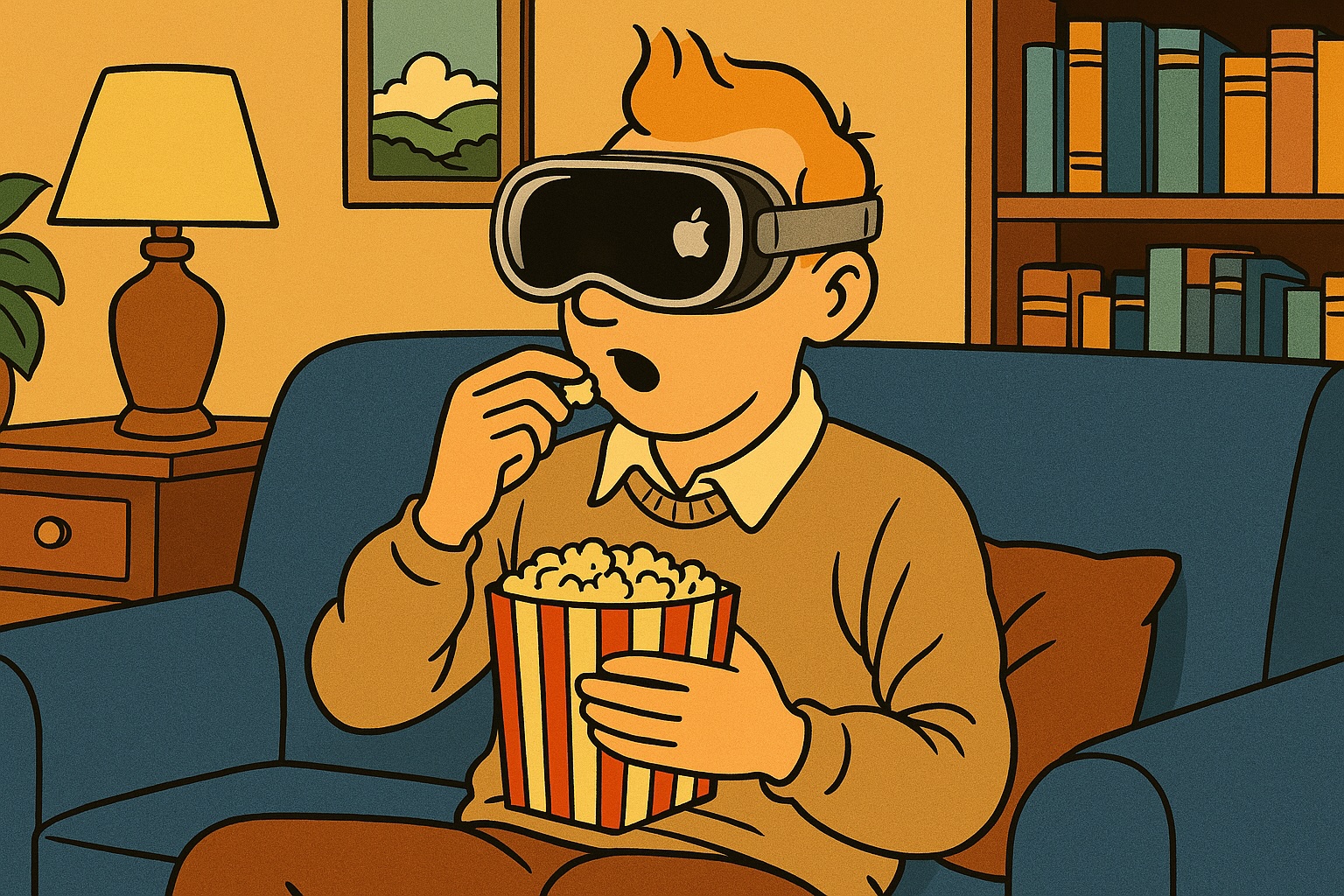


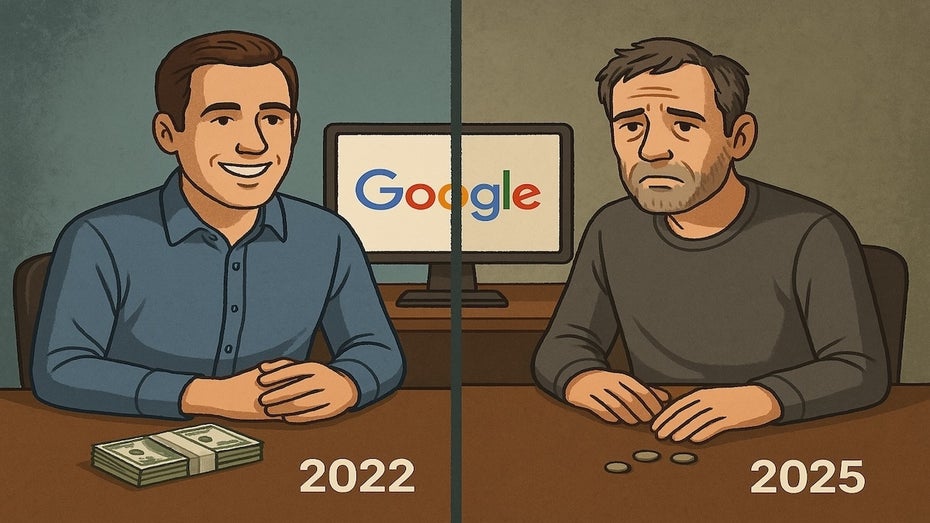



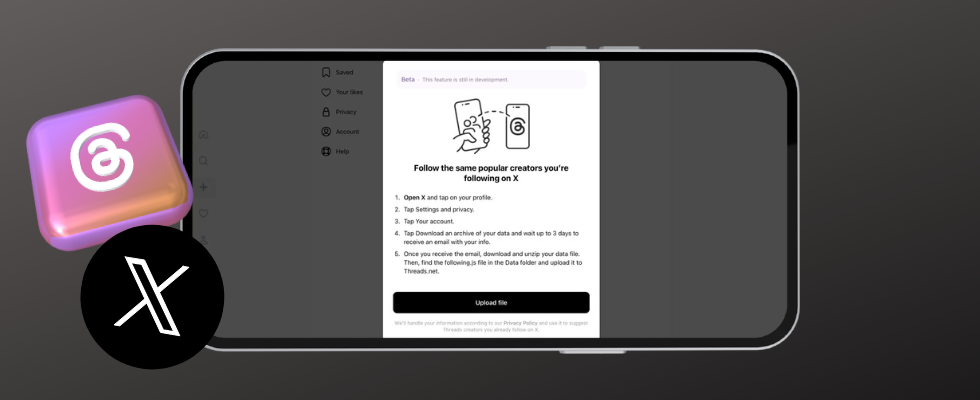

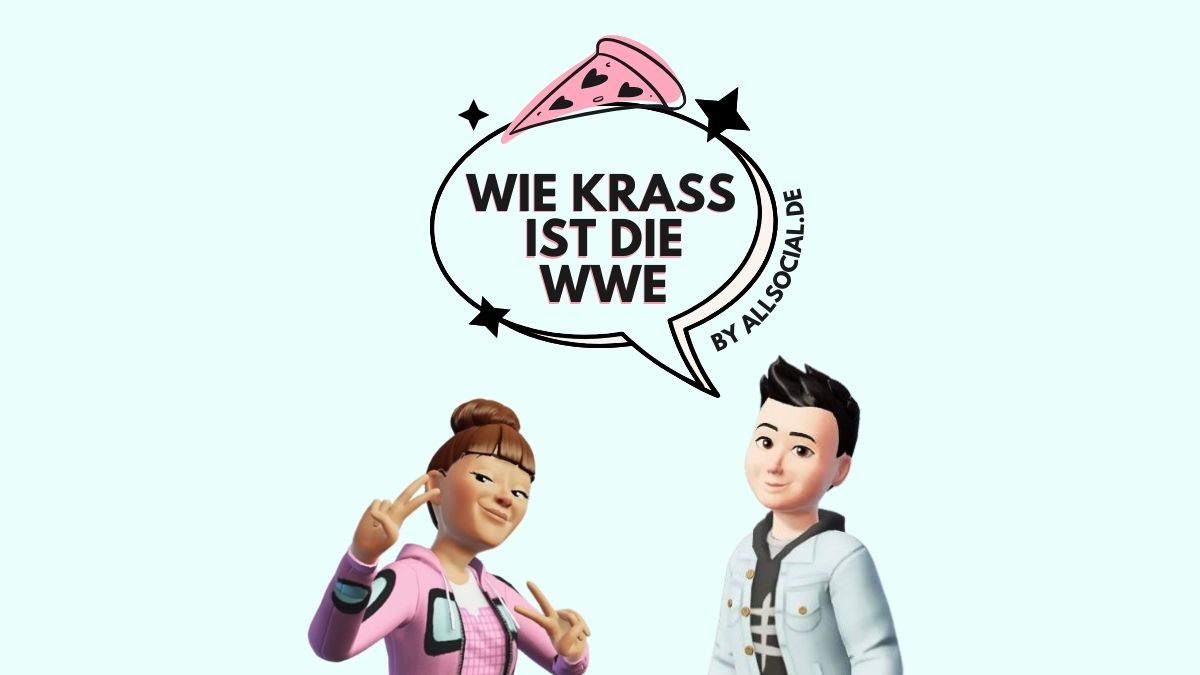



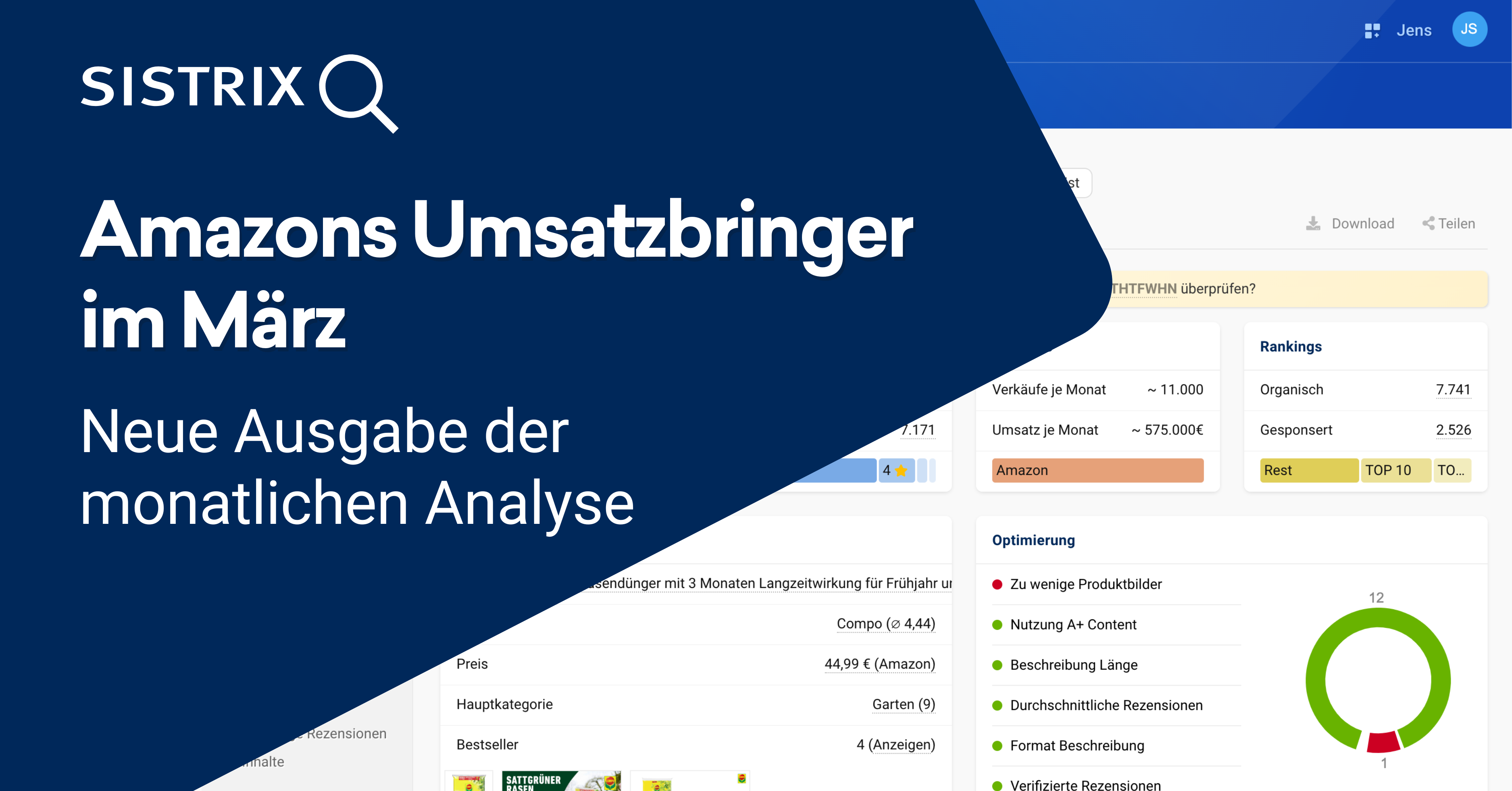

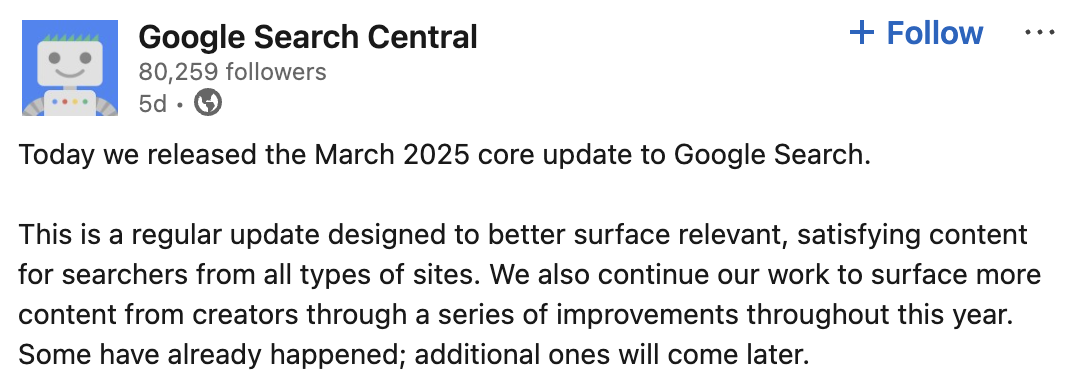
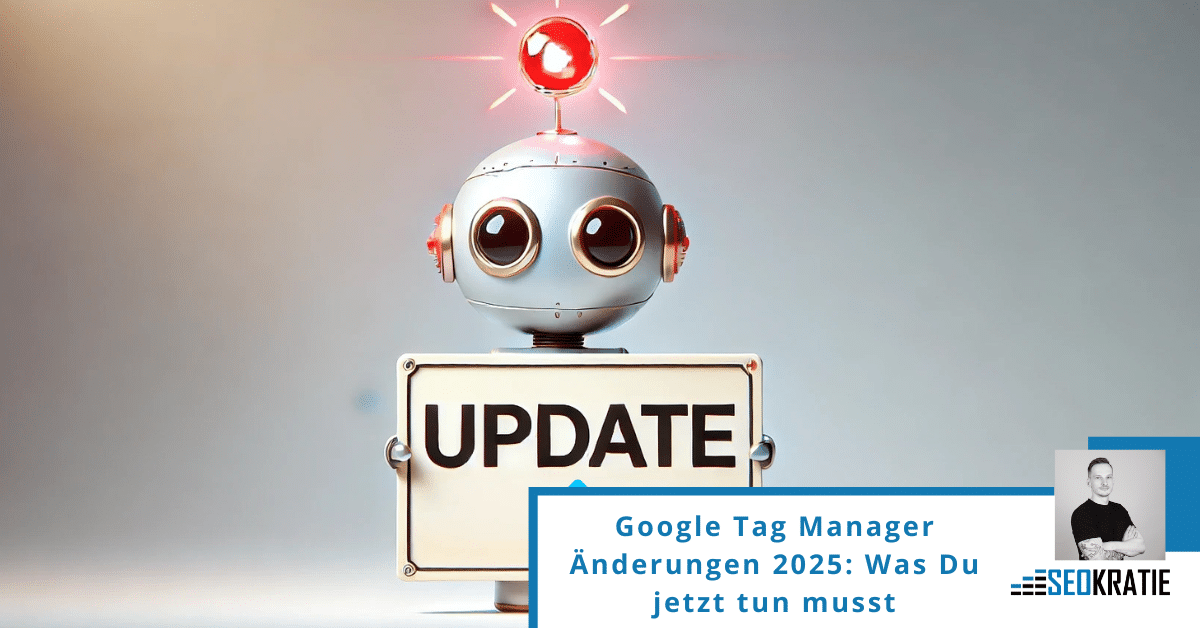



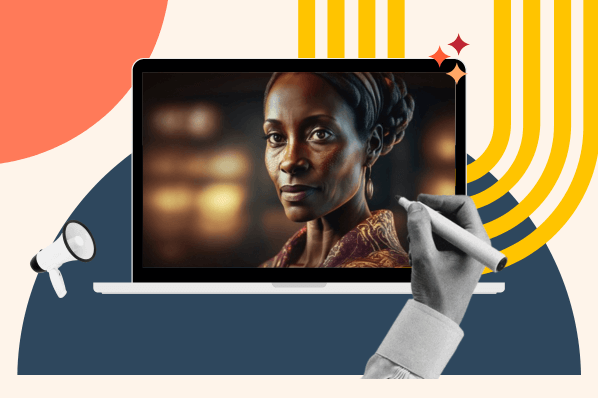


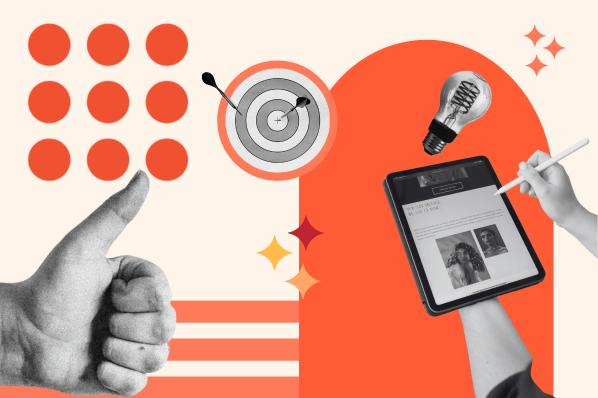

![SEO-Monatsrückblick März 2025: Google AIO in DE, AI Mode, LLMs + mehr [Search Camp 369]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/03/Search-Camp-Canva-369.png)
![Warum die Google Search Console eines der wichtigsten Relaunch-Werkzeuge ist [Search Camp 368]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-368.png)



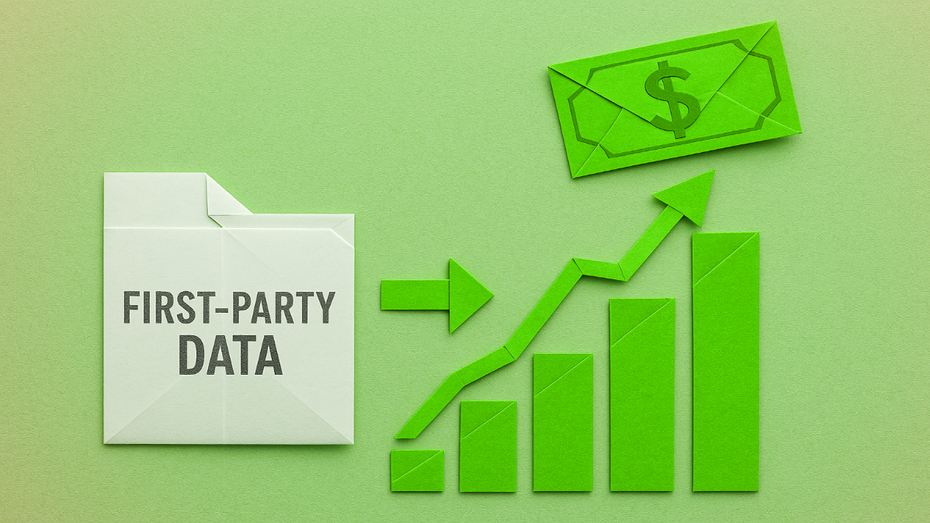









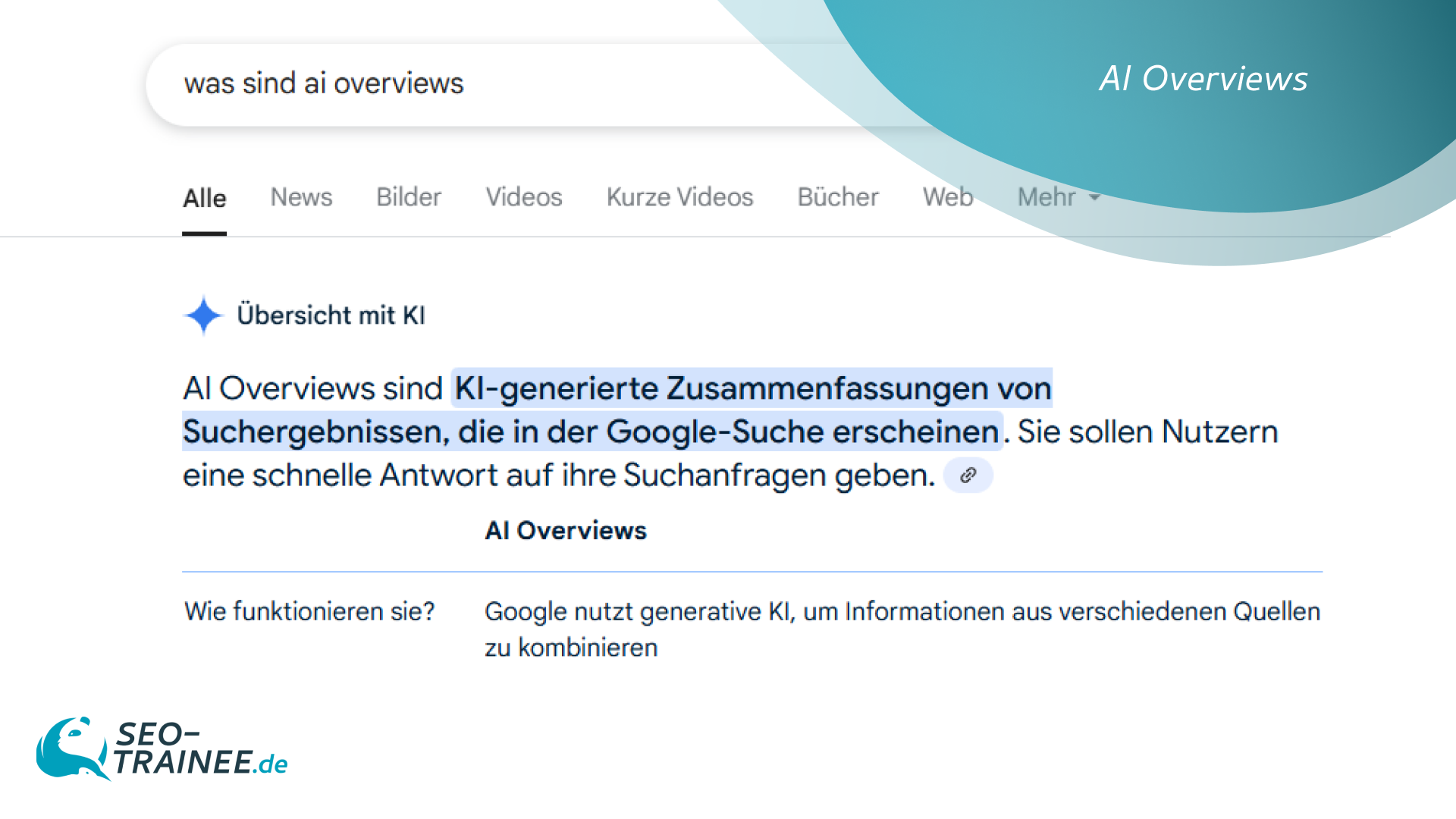




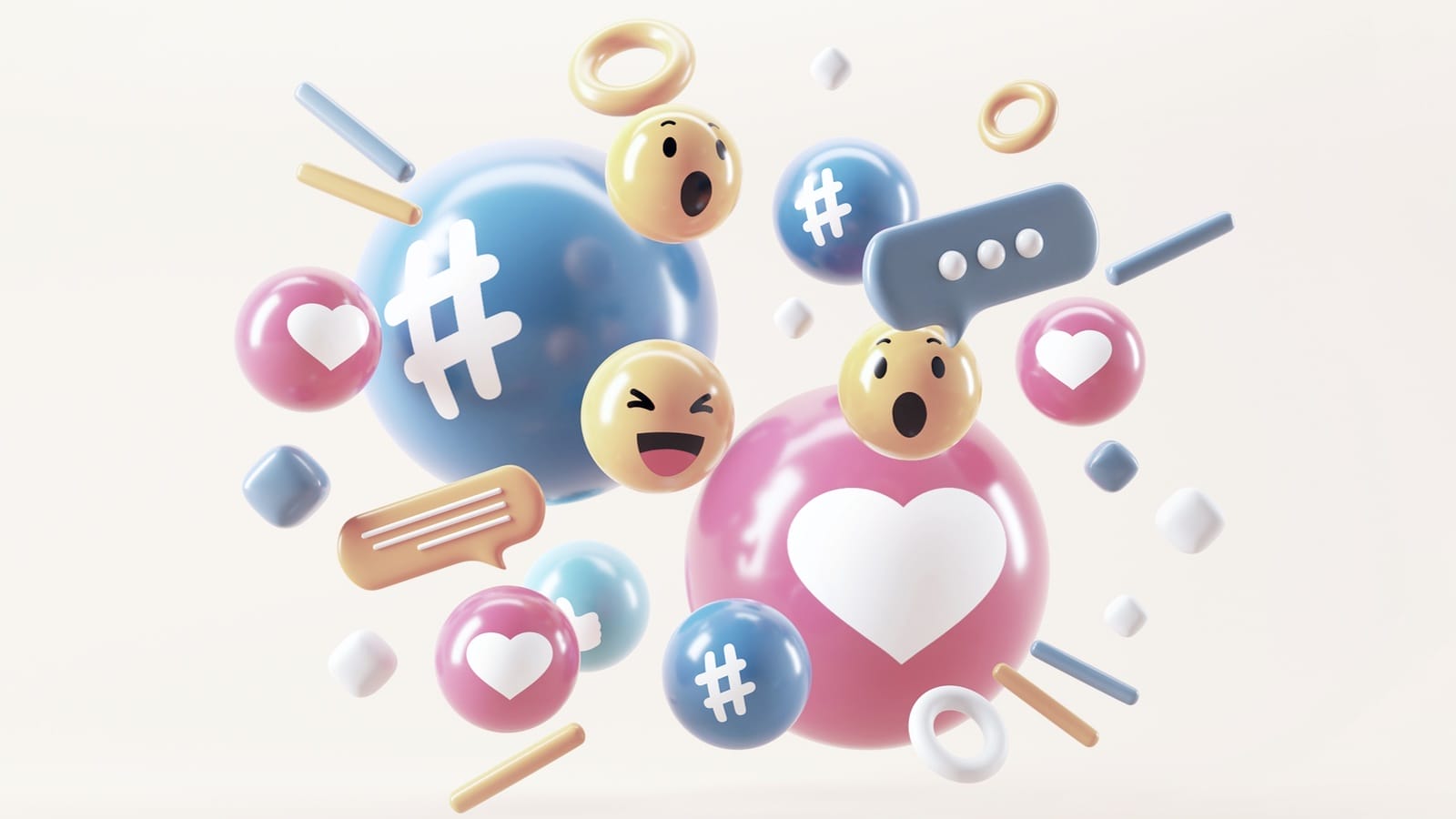






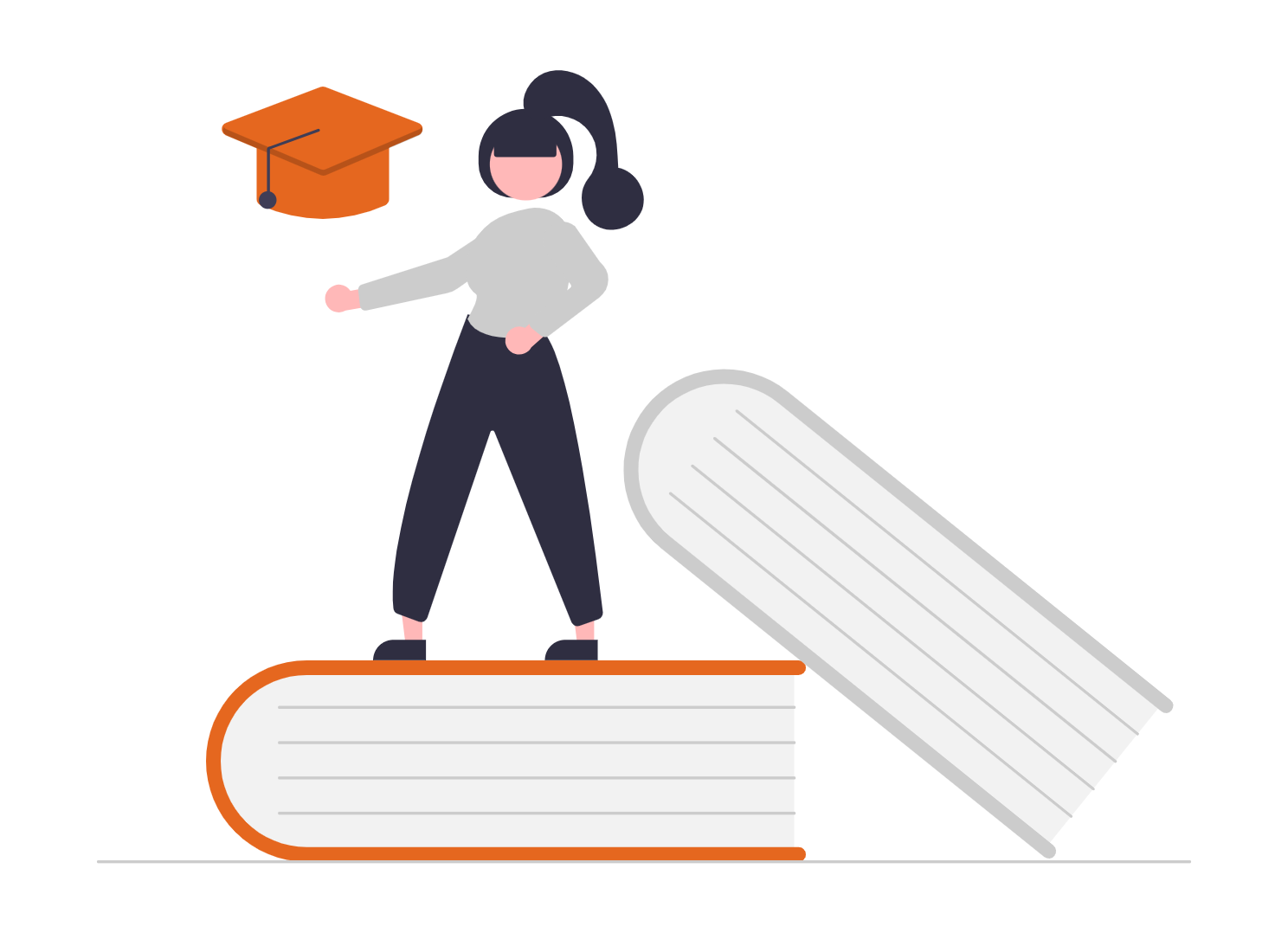


























































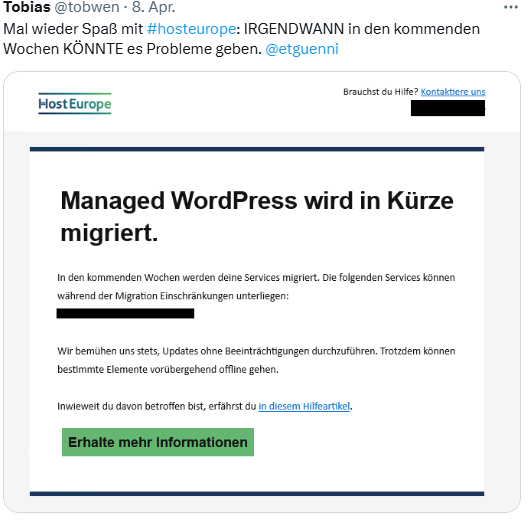




:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/a9/54a902844e363a881f3d8bd538531216/0124152041v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9f/0f/9f0fffdf2f21737fd70ba11ac0e50614/0123910898v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/6b/c76bdbffb42a392f764c560bfaf3c5b1/0123961518v1.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e8/3d/e83d8bf07530e12c205de74a8fa2be67/0124111701v2.jpeg?#)